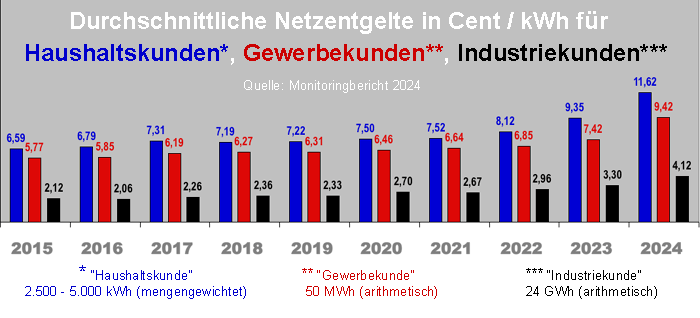 |
| Aufgrund des Bandlastprivilegs zahlen bisher die größten industriellen Stromverbraucher nur einen Bruchteil des Netzentgelts, das den Haushaltskunden und der Masse der Gewerbekunden abverlangt wird. |
Januar 2025 |
250105 |
ENERGIE-CHRONIK |
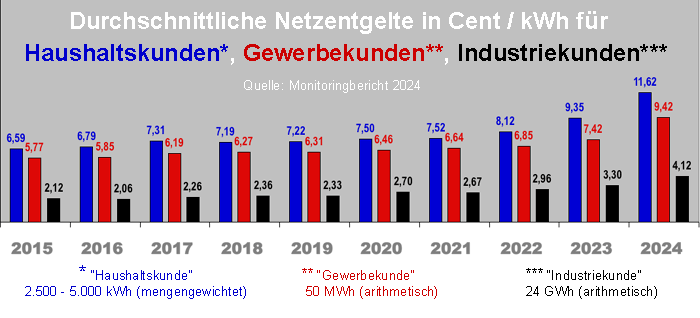 |
| Aufgrund des Bandlastprivilegs zahlen bisher die größten industriellen Stromverbraucher nur einen Bruchteil des Netzentgelts, das den Haushaltskunden und der Masse der Gewerbekunden abverlangt wird. |
Das "Bandlastprivileg" befreit industrielle Großstromverbraucher bis heute weitgehend von den Netzentgelten. Ursprünglich wurde es damit begründet, dass der annähernd gleichbleibende Bezug großer Strommengen die Netzregelung erleichtere. Das war schon immer eine fragwürdige Behauptung, die ähnlich wie das Konstrukt der "vermiedenen Netzentgelte" (221208) vor allem eine Begünstigung legitimieren sollte, für die es sachlich keine einleuchtende Begründung gab. Inzwischen steht auch für die Bundesnetzagentur fest, dass "unflexibles Lastverhalten Situationen kritischer Netzzustände verschärfen und sich somit netzschädlich auswirken" kann. Vor einem halben Jahr veröffentlichte die Behörde deshalb ihre "Eckpunkte zur Fortentwicklung der Industrienetzentgelte im Elektrizitätsbereich", die darauf hinauslaufen, das Bandlastprivileg abzuschaffen. Die Vergünstigung soll allerdings nicht einfach entfallen, sondern so modifiziert werden, dass sie den Großstromverbrauchern ersatzweise einen möglichst flexiblen Strombezug honoriert (PDF). In dieselbe Richtung zielt eine Publikation der Denkfabrik "Agora Energiewende", die kurz vor Jahresende erschien (PDF).
"Die Bandlast reizt zu einem konstanten Abnahmeverhalten durch stromintensive Letztverbraucher an", stellte die Bundesnetzagentur in ihrem Papier fest. Anders als in der Vergangenheit habe dies überwiegend keinen Nutzen mehr im Hinblick auf Netzkostensenkungen oder Netzstabilität. Der immer weiter voranschreitende Ausbau der erneuerbaren Energien führe zu einer zunehmenden Prägung des Erzeugungsmarkts durch eine volatile Residuallast. Durch den Ausstieg aus der Kernenergie und aus der Kohleverstromung sinke der Anteil der Erzeugung aus klassischen Grundlastkraftwerken stetig. Damit schwinde auch das Interesse an einer hohen, gleichmäßigen Leistungsaufnahme stromintensiver Letztverbraucher. Durch den Wegfall konventioneller Grundlastkraftwerke und den Zubau dezentraler Einspeisung aus Anlagen zur Erzeugung von EE-Strom werde die Einspeisung volatiler, was auch das Erfordernis flexibler Lasten wachsen lässt. Unflexibles Abnahmeverhalten sei "gesamtökonomisch nachteilhaft" und könne dadurch die Integration erneuerbarer Energien in den Strommarkt hemmen. Auch könnten sich dadurch "Situationen kritischer Netzzustände verschärfen".
In ähnlicher Weise heißt es in dem Agora-Papier, dass die Bandlast-Privilegierung in einem Stromsystem mit Grundlastkraftwerken zwar "nachvollziehbar" gewesen sei, aber Im Zuge der Energiewende einen falschen Anreiz für Inflexibilität und gleichmäßige Stromabnahme darstelle. Dies könne "Situationen kritischer Netzzustände weiter verschärfen und sich damit netzschädlich auswirken".
Voraussetzung für das Bandlast-Privileg ist bisher nach § 19 Abs. 2 der Stromnetzentgeltverordnung eine Strommenge von mindestens 10 Gigawattstunden pro Kalenderjahr, die mindestens 7000 Stunden lang aus dem öffentlichen Netz bezogen wird. Das Netzentgelt wird dann auf bis auf ein Fünftel des Normalsatzes gesenkt. Bei 8000 Stunden sinkt es sogar bis auf ein Zehntel.
Im vergangenen Jahr erzielten so rund 400 Industriebetriebe, die mit 90 Terawattstunden etwa die Hälfte des deutschen Industriestrombedarfs bezogen, Einsparungen von mehr als einer Milliarde Euro. Diese entgangenen Erlöse wurden von den Netzbetreibern auf die Gesamtheit der Netznutzer abgewälzt und verteuerten das Netzentgelt pro Kilowattstunde um 0,643 Cent. Der Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden finanzierte so das Bandlastprivileg der industriellen Großverbraucher mit 23 Euro, während der Gewerbekunde mit einem Jahresverbrauch von 50 Megawattstunden zusätzlich 322 Euro bezahlen mussten.
Die Begünstigung von Großverbrauchern wurde bereits mit der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) vom 25. Juli 2005 eingeführt: Diese sah in § 19 die Gewährung eines verminderten "individuellen Netzentgelts" vor, wenn die Höchstlast des Letztverbrauchers voraussichtlich erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast abweicht. Dieselbe Regelung galt, wenn die Stromabnahme über mindestens 7500 Stunden im Jahr erfolgte und zehn Gigawattstunden überstieg. Das "individuelle Netzentgelt" durfte aber nicht weniger als die Hälfte des normalen Netzentgelts betragen und war von der Regulierungsbehörde zu genehmigen.
Im Juli 2011 kam es dann zu einer Neufassung dieses Paragraphen der Stromnetzentgeltverordnung, die mit einem einzigen Satz die größten Stromverbraucher grundsätzlich von den Netzentgelten befreite, weil sie – so lautete die Begründung – "aufgrund ihrer Bandlast netzstabilisierend wirken". Dieser Satz lautete: "Erreicht die Stromabnahme aus dem Netz der allgemeinen Versorgung für den eigenen Verbrauch an einer Abnahmestelle die Benutzungsstundenzahl von mindestens 7.000 Stunden und übersteigt der Stromverbrauch an dieser Abnahmestelle 10 Gigawattstunden, soll der Letztverbraucher insoweit grundsätzlich von den Netzentgelten befreit werden."
In der Öffentlichkeit wurde diese Änderung zunächst gar nicht wahrgenommen, da sie Teil des "Gesetzes zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften" vom 26. Juli 2011 war, das mehr oder weniger kleine Änderungen an diversen Gesetzen vornahm, vom Wertpapiergesetz bis hin zum KWK-Gesetz. Eine Änderung der Stromnetzentgeltverordnung war in den insgesamt sieben Artikeln des Gesetzentwurfs zunächst auch gar nicht vorgesehen gewesen. Sie wurde dem Artikelgesetz erst kurz vor der Verabschiedung im Parlament zu später Stunde über eine Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses eingefügt, weshalb der geänderte § 19 auch als "Mitternachtsparagraph" bezeichnet wurde.
Publik wurde dieser Coup der Lobby und ihrer Helfer im Wirtschaftsausschuss erst Monate später durch einen Bericht des ARD-Fernsehmagazins "Monitor" am 27. Oktober 2011. Zuvor hatte die Bundesnetzagentur am 11. Oktober einen "Sonderkundenaufschlag" auf die Netzentgelte angekündigt, um die durch den "Mitternachtsparagraph" entfallenden Einnahmen den übrigen Stromverbrauchern abzuverlangen (111004, 111109).
Zunächst wollte die Bundesnetzagentur die Totalbefreiung der Großverbraucher
von den Netzentgelten auch noch rückwirkend für das ganze Jahr 2011 gelten lassen,
was vom Oberlandesgericht Düsseldorf jedoch untersagt wurde (121203).
Ein Vierteljahr später stellte dasselbe Gericht fest, dass dem "Mitternachtsparagraphen"
von vornherein die Rechtsgrundlage gefehlt hatte, weil das Energiewirtschaftsgesetz
eine Totalbefreiung von den Netzentgelten gar nicht zuließ (130303).
Die schwarz-gelbe Bundesregierung sah sich deshalb gezwungen, die Totalbefreiung
wieder abzuschaffen. In der Praxis änderte sich aber nicht sonderlich viel.
Der neugefasste § 19 Abs. 2 StromNEV
ersetzte lediglich die bisherige Totalbefreiung der größten Stromverbraucher
mit einem Jahresverbrauch von mehr als 10 Gigawattstunden durch eine Mindestbeteiligung
an den normalen Netzentgelten, die je nach Benutzungsstundenzahl 10, 15 oder
20 Prozent des Normalsatzes beträgt und bis heute in Kraft ist.
Am selben Tag, an dem das Oberlandesgericht Düsseldorf den "Mitternachtsparagraphen" für ungültig erklärte, teilte
die EU-Kommission in Brüssel dem damaligen Bundesaußenminister
Westerwelle mit, daß sie die für nichtig erklärte Neuregelung des § 19
StromNEV überprüfen werde. Beim gegenwärtigen Stand sei sie der
Auffassung, daß es sich bei der Umlegung der dadurch verursachten Kosten
auf die Stromverbraucher um staatliche Mittel handeln könnte und daß
die Begünstigten dadurch einen selektiven Vorteil gegenüber
Wettbewerbern in anderen Mitgliedstaaten erhalten. Sie wolle außerdem
untersuchen, ob bereits die weitgehende Befreiung der
Großstromverbraucher vor der Änderung von § 19 StromNEV eine verbotene
Beihilfe darstellte (130303).
Grundlage für die Einleitung des EU-Prüfverfahrens waren zwei im
November und Dezember 2011 eingegangene Beschwerden des Bundes der
Energieverbraucher und der Stadtwerke Hameln.
Die damit angestoßene Überprüfung führte zu einem Sanktionsbeschluss,
den die zuständige Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestagher am 28.
Mai 2018 unterzeichnete. Demnach verstieß die vollständige Befreiung von den Netzentgelten
sowohl gegen den Artikel 107 Abs. 1 als auch den Artikel 108
Abs. 3 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Die
Bandlastverbraucher mussten deshalb die in den Jahren 2012 und 2013
rechtswidrig kassierten Vorteile einschließlich Zinsen zurückzahlen (180514).
Allerdings wollten weder die industriellen Großverbraucher noch die
ihnen zugetane Bundesregierung diesen Beschluss akzeptieren. Sie
beantragten deshalb beim Gericht der Europäischen Union (EuG) in
Luxemburg seine Nichtigkeitserklärung. Dabei strapazierten sie exzessiv
das Märchen von der netzstabilisierenden Bandlast (Hintergrund,
Juli 2015). Sie behaupteten, dass die vollständige
Befreiung von den Netzentgelten "eine Gegenleistung für den Beitrag der
Bandlastverbraucher zur allgemeinen Stabilität des Stromnetzes" sei. Es
handele sich um einen "Ausgleich für eine Dienstleistung
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse". Die Bandlast sei sogar
"Voraussetzung für eine
kontinuierliche Stromerzeugung aus Kraftwerken mit Synchrongeneratoren".
Die vollständige Befreiung von den Netzentgelten entspreche "der Logik
des Netzentgeltsystems in Deutschland" und müsse als
"angemessene Gegenleistung für den Beitrag der Bandlastverbraucher zur
Netzstabilität betrachtet werden".
Diese Argumente waren schon damals an den Haaren herbeigezogen oder
sogar purer Unsinn. Der Antrag auf Nichtigkeitserklärung wurde deshalb
vom Gericht der Europäischen Union am 6. Oktober 2021 abgewiesen.
Daraufhin klagten die Unterlegenen in zweiter Instanz vor dem
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH). Aber auch damit erreichten
sie nur eine weitere Verzögerung: Am 26. September 2024 bestätigte der
EuGH das Urteil der Vorinstanz.
Es dauerte also insgesamt elf Jahre ab der Ankündigung des
Prüfverfahrens, bis die EU-Kommissarin Vestagher ihren Beschluss endlich
in trockenen Tüchern hatte. Das lag aber nicht an der Kommissarin, die
im Unterschied zu etlichen anderen Kommissionsmitgliedern – man denke
nur an den einstigen Energiekommissar Günther Oetttinger (101104)
– eine außergewöhnlich kompetente und tüchtige Besetzung war. Die mehr
als sechsjährige Verzögerung verursachten die industriellen
Großstromverbraucher und die mit ihnen verbandelte Bundesregierung, indem sie
ein letztes Gefecht um die Aufrechterhaltung eines skandalösen Privilegs
führten. Die dadurch entstehenden Kosten zahlten letzten Endes auch
die Stromverbraucher bzw. der Steuerzahler.
"Trotz des Urteils bestehen ähnliche Praktiken fort", erklärte dazu der Bund der Energieverbraucher, der mit seiner Beschwerde seinerzeit das Prüfverfahren der EU-Kommission in Gang gebracht hat. Wie er am 17. Januar mitteilte, forderte er jetzt die 4. Beschlusskammer der Bundesnetzagentur auf, auch die abgeschwächte Begünstigung der industriellen Großverbraucher zu unterbinden, die ab 2014 die Totalbefreiung von den Netzentgelten ersetzte und bis heute praktiziert wird. Die gewährten Rabatte entsprächen weder den Vorgaben des § 19 Abs. 2 StromNEV noch den EU-Vorschriften. Die ungerechtfertigten Kosten müssten den Verbrauchern erstattet werden. Ferner verlangt der Verband die Offenlegung der Liste der begünstigten Unternehmen. Nur so könnten gegebenenfalls rechtliche Schritte eingeleitet werden.
"Nach wie vor genehmigt die Bundesnetzagentur individuelle Netzentgelte, die fast die Hälfte des Stromverbrauchs der Industrie begünstigen", erklärte der Verbandsvorsitzende Aribert Peters. "Das sind Entlastungen im Volumen von rund 1,5 Milliarden Euro jährlich. Die Kosten werden weiterhin auf Haushalte und nichtprivilegierte oft mittelständische Unternehmen umgelegt. Der Strompreis verteuerte sich dadurch 2024 um 0,643 ct/kWh bzw. 32 Euro für einen Durchschnittshaushalt. Es ist untragbar, dass Verbraucher und Mittelstand die Strompreise der Industrie finanzieren."