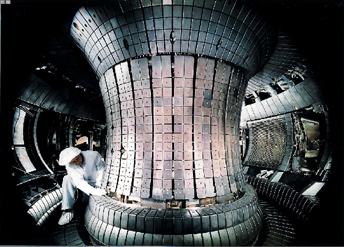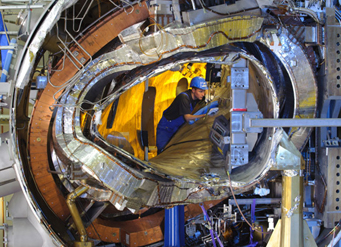| 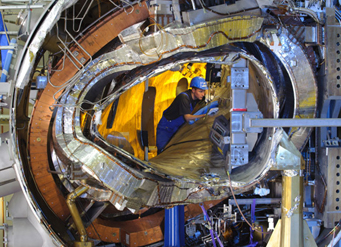
|
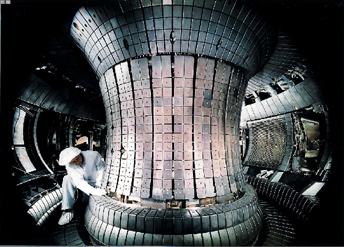
|
| Wie aus der Schrottpresse: So sieht
der Torus des 2014 fertiggestellten "Stellarators" Wendelstein 7-X aus,
in dem das Plasma von Magnetfeldern in der Schwebe gehalten wird. Die
gequetschte Form ist das Ergebnis ausgefeilter Berechnungen zur Erzeugung
eines besonders stabilen und wärmeisolierenden magnetischen Käfigs.
|
Schön symmetrisch: Beim konkurrierenden
Prinzip des "Tokamak" ist die Bauweise einfacher. Ein großer Nachteil
gegenüber dem "Stellarator" ist aber die Instabilität des Plasmas,
die nur einen pulsierenden Betrieb ermöglicht. Das Foto zeigt den
ASDEX Upgrade, den das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching
seit 1991 betreibt. |
| |
Fotos (2): IPP |
Bundesregierung will Fusions-Forschung mit über zwei Milliarden Euro fördern
Die Bundesregierung beschloss am 1. Oktober einen "Aktionsplan",
um die Fusionsforschung stärker als bisher zu fördern. Unter dem Titel "Deutschland
auf dem Weg zum Fusionskraftwerk" (PDF) kündigte sie an, für diesen Zweck bis 2028 insgesamt
mehr als zwei Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Damit will sie die Inbetriebnahme
des "ersten Fusionsreaktors der Welt in Deutschland" vorantreiben,
wie sie im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD etwas voreilig zum Ziel
einer Regierung erklärt wurde, die spätestens Anfang 2029 wieder abtreten muss
(250403). Die Realisierung einer für die
Stromerzeugung verwertbaren Kernfusion ist jedenfalls weltweit nicht vor Mitte
des Jahrhunderts zu erwarten, wie die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
festgestellt hat (241206). Schon aus diesem
Grund wird die Kernfusion deshalb auch keinen Beitrag zur Erreichung der bis
dahin gesteckten Klimaziele leisten können (PDF).
Der "erste Fusionsreaktor der Welt in Deutschland" war von Anfang
an vor allem ein politischer Formelkompromiss
Bei diesem Punkt des Koalitionsvertrags handelte es sich von Anfang an weniger
um ein reales Ziel als um einen politischen Formelkompromiss: Den Unionsparteien
wurde es so gesichtswahrend ermöglicht, mit einem Bekenntnis zur relativ "sauberen"
und von der Realisierung noch weit entfernten Stromerzeugung mittels Kernfusion
in plakativer Weise an der "Option Kernenergie" festzuhalten (250801).
Als Gegenleistung mussten die Unionsparteien von ihren früheren Forderungen
nach einer Verlängerung oder gar Neubelebung der konventionellen Kernenergie
abrücken. Sonst wäre die SPD nicht zu einer gemeinsamen Regierung bereit gewesen.
Im Koalitionsvertrag werden deshalb die auf Kernspaltung basierenden und inzwischen
allesamt stillgelegten Kernkraftwerke mit keinem Wort erwähnt.
Höhe der bisherigen Förderung steigt ungefähr um das Dreifache
Die im Koalitionsvertrag vorgesehene Stromerzeugung mit Wärme aus Kernfusion
steht also zumindest die nächsten zwei Jahrzehnte gar nicht zur Verfügung. Auch
nach dem Ende der jetzigen Regierung werden mindestens noch drei bis vier Legislaturperioden
vergehen, bevor Fusionskraftwerke technisch realisierbar wären und praktische
Bedeutung erlangen könnten. Das setzt Union und SPD unter Druck, durch eine
Aufstockung der finanziellen Mittel für die einschlägige Forschung zumindest
den Anschein zu erwecken, als ob es auch schneller gehen könnte. Die mehr als
zwei Milliarden Euro, die sie jetzt im Rahmen der vierjährigen Legislaturperiode
zur Verfügung stellen wollen, entsprechen pro Jahr über 500 Millionen Euro und
mehr als dem Dreifachen der bisherigen Förderung, die vom Bundesforschungsministerium
zuletzt mit ungefähr 150 Millionen Euro beziffert wurde.
Denn es ist keineswegs so, dass die Forschung zur Kernfusion bisher leichtsinnigerweise
vernachlässigt worden wäre. Der jetzt von der schwarz-roten Bundesregierung
beschlossene "Aktionsplan" knüpft sogar direkt an ein ganz ähnliches Projekt
an, das die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP im März 2024 unter dem Titel
"Förderprogramm Fusion 2040 – Forschung auf dem Weg zum Fusionskraftwerk"
vorgelegt hat (PDF).
Was sich ändert, ist lediglich die Höhe der Gelder, mit denen die Lobby der
Fusionsbranche künftig rechnen kann.
Nutznießer sind vor allem vier Unternehmen, die auf jeweils unterschiedliche
Weise die Kernfusion herbeiführen wollen
Nutznießer der erhöhten Geldflüsse sind vier Unternehmen bzw. Lobbyverbände,
die auf jeweils unterschiedliche Weise die noch immer ungelösten technischen
Probleme der Kernfusion in den Griff zu bekommen versuchen. Denn bisher gibt
es trotz jahrzehntelanger Bemühungen und einer ganzen Anzahl von Versuchsanlagen
weltweit keinen einzigen Forschungsreaktor, der dauerhaft mehr Energie erzeugen
kann als er selber verbraucht. Diese vier Unternehmen sind alle zwischen 2019
und 2023 entstanden und im Lobbyregister des Bundestags verzeichnet. Sie sind
nicht nur in Deutschland aktiv, sondern kooperieren international, vor allem
mit Partnern in den USA. Zugleich verfügen sie aber nur über geringes Eigenkapital
und so gut wie keine Einnahmen aus dem laufenden Geschäft, weshalb sie auf Zuwendungen
des Staats, ihrer Gesellschafter oder anderer Gönner so existentiell angewiesen
sind wie Fische auf das Wasser.
Gauss Fusion GmbH
Dieses Unternehmen wurden im Juni 2022 von privaten Industrieunternehmen
aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien gegründet und arbeitet mit
führenden Forschungseinrichtungen zusammen. Dazu gehören CERN, das Max-Planck-Institut
für Plasmaphysik (IPP), das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), ENEA
und die TU Eindhoven. Der Firmenname wurde offenbar von der älteren Maßeinheit
für die magnetische Flussdichte abgeleitet, an deren Stelle inzwischen "Tesla"
getreten ist. Die falsche Schreibweise "Gauss" statt "Gauß" ist dabei nicht
der neuen Rechtschreibung geschuldet, sondern kam wohl mit Rücksicht auf die
internationalen Partner zustande. Das Unternehmen verfügt laut Handelsregister
über ein Eigenkapital von 2 Millionen Euro und ist damit weit besser ausgestattet
als seine drei Konkurrenten. Am 9. Oktober hat die Gauss Fusion GmbH einen
Kosten- und Zeitplanrahmen für ein erstes kommerzielles Fusionskraftwerk namens
GIGA vorgelegt, in dem sie die Kosten dieses Projekts mit 15 bis 18 Milliarden
Euro veranschlagt.
Proxima Fusion GmbH
Diese Firma wurde ebenfalls
von Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik initiiert und im
März 2023 in München ins Handelsregister eingetragen.
Im
Unterschied zur Gauss Fusion GmbH beabsichtigt sie aber nicht die Weiterentwicklung
des "Tokamak", sondern will auf Basis des "Stellarators" einen funktionstüchtigen
Fusionsreaktor entwickeln. Inzwischen
hat sie ihr Stammkapital
von zunächst nur 20.000 Euro auf 63.218 Euro erhöht. Wie
sie am 9. Oktober mitteilte, hat sie außerdem insgesamt 200 Millionen Euro
für die Entwicklung eines kommerziellen Fusionskraftwerks bis
2030 eingesammelt, das mit
"QI-HTS-Stellaratoren" genügend Wärme zur
Stromerzeugung liefern soll. An diesem Ziel arbeite ein
Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren von führenden Unternehmen und Institutionen
wie dem IPP, dem MIT, Harvard, SpaceX, Tesla und McLaren, das inzwischen auf
rund hundert Mitarbeiter angewachsen sei.
Marvel Fusion GmbH
Dieses Unternehmen wurde im
Juli 2019 gegründet und hat seinen
Sitz ebenfalls in München. Es verfolgt einen speziellen
Ansatz, indem es als Brennstoff nicht Deuterium-Tritium
verwendet, sondern Bor-Protonen, wobei die Fusion
durch hochintensive Laser angestoßen wird. Es
handelt sich um einen Zusammenschluss von Wissenschaftlern der Ludwig-Maximilians-Universität
München (LMU), der Extreme Light Infrastructure for Nuclear Physics (ELI-NP),
der Stanford University und des Massachusetts Institute of Technology (MIT),
die gemeinsam dieses Fusionskonzept verwirklichen wollen. Die Marvel Fusion
GmbH kann sich dabei auf über 385 Millionen Euro an Zuwendungen von öffentlichen
und privaten Geldgebern stützen. Eine zwischen ihr und der Ludwig-Maximilians-Universität
geschlossene Kooperationsvereinbarung wird vom Land Bayern mit 2,5 Millionen
Euro unterstützt. Das Eigenkapital des Unternehmens beträgt laut Handelsregister
132.780 Euro.
Focused Energy GmbH
Die Focused Energy GmbH wurde im August 2021 in Darmstadt ins Handelsregister
eingetragen. Als Eigenkapital werden bis heute nur 25.000 Euro angegeben.
Zweiter Firmensitz ist Redwood City im US-Staat Kalifornien. Es handelt sich
um ein Technologie-Spin-off der Universität Darmstadt, das mit dem US-Unternehmen
National Energetics (Texas) kooperiert. Focused Energy verfolgt wie Marvel
Fusion das Konzept einer Laser-gesteuerten Fusion, verwendet dabei jedoch
den konventionelleren Deuterium-Tritium-Ansatz der National Ignition Facility
(NIF). Finanziell unterstützt wurde das Unternehmen unter anderem durch die
deutsche Bundesagentur für disruptive Innovation, die ihm den mit 50 Millionen
Dollar dotierten SPRIN-D-Preis verlieh. Laut seiner jüngsten Selbstdarstellung
"beschäftigt das weltweit führende Laserfusionsunternehmen die rund 100 besten
Köpfe einschlägiger Forschungsinstitute und Universitäten in Europa und den
USA".
Proxima, Marvel und Focused Energy verlangten "mindestens 3 Milliarden
Euro bis 2029"
Eine Woche vor dem angekündigten Kabinettsbeschluss über den "Aktionsplan"
zur Förderung der Kernfusion veröffentlichten drei dieser vier Unternehmen –
Proxima, Marvel und Focused Energy – einen Appell an die Bundesregierung, in
dem sie eine "staatliche Anschubfinanzierung von mindestens 3 Milliarden
Euro bis 2029" für das von ihnen betriebene Geschäft verlangten. Nur so
könnten sie "privates Kapital in großem Umfang mobilisieren und den Weg
zum ersten Fusionskraftwerk in Deutschland ebnen".
Die Gauss Fusion GmbH bezifferte die Kosten ihres Projekts mit 15
bis 18 Milliarden Euro
Die Gauss Fusion GmbH beteiligte sich
nicht an diesem Appell. Stattdessen präsentierte sie eine Woche nach dem Kabinettsbeschluss
ihren Entwurf für die Entwicklung eines Fusionskraftwerks, dessen Realisierung
bis Mitte der vierziger Jahre möglich sein soll und dann 15 bis 18 Milliarden
Euro kosten würde. Diese Summe wäre tatsächlich GIGA, wie der verheißungsvolle
Name des Projekts lauten soll. Und da der Preisstand des Jahres 2025 zugrunde
gelegt wurde, dürfte sie sich bis Mitte der vierziger Jahre schon inflationsbedingt
noch stark erhöhen.
Die Leistung des geplanten Fusionskraftwerks
GIGA wurde nicht genannt. Sie dürfte sich aber bestenfalls im üblichen Bereich
konventioneller Kernkraftwerke bewegen, die deutlich weniger kosten. Sogar der
finanziell völlig entgleiste KKW-Neubau Olkiluoto 3 in Finnland war trotz einer
fast dreifachen Kostenüberschreitung um 4 bis 7 Milliarden Euro billiger.
Das erste Fusionskraftwerk wäre von einer geradezu erdrückenden Unwirtschaftlichkeit
Auch ohne Kostenüberschreitungen sind konventionelle
Kernkraftwerke schon jetzt viel zu teuer, um mit dem Strom aus erneuerbaren
Energien konkurrieren zu können. So hat Frankreichs EDF die Baukosten für weitere
Kernkraftwerke vom Typ EPR auf mindestens 8,4 Milliarden Euro nach oben korrigiert,
nachdem beim ersten inländischen EPR in Flamanville die ursprünglich veranschlagten
3,4 Milliarden auf über 19 Milliarden explodiert sind. Da für das GIGA-Fusionskraftwerk
die Baukosten sogar doppelt so hoch veranschlagt werden, ergäbe sich somit für
Kraftwerke, die mit Wärme aus Kernfusion betrieben werden, eine geradezu erdrückende
Unwirtschaftlichkeit.
Links (intern)
- Wie die Kernfusion in den Koalitionsvertrag gelangte (250801)
- Mit "Kernenergie light" kommt die CDU sowohl der SPD als auch der CSU entgegen (250403)
- Auf die "Option Kernkraft" will die CDU nicht verzichten (250202)
- Kernfusion kann frühestens nach 2045 nennenswert zur Stromversorgung beitragen
(241206)
Links (extern, ohne Gewähr)
- PDF ESYS-Schriftenreihe "Kurz erklärt!": Ist Kernfusion
eine Energiequelle der Zukunft? (21 S.)
- PDF
Wiss. Dienste Bundestag: Kernfusion – Finanzierung und Prognosen (18 S.)
- PDF Aktionsplan des BMFTR: Deutschland auf dem Weg zum
Fusionskraftwerk (12 S.)
- PDF
Förderprogramm Fusion 2040 – Forschung auf dem Weg zum Fusionskraftwerk
(49 S.)