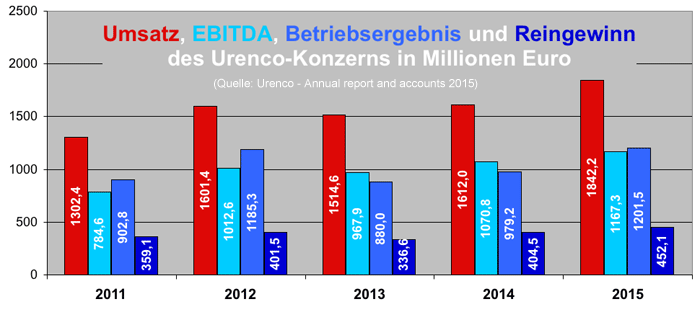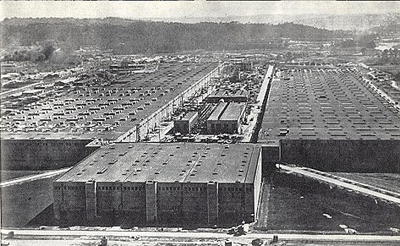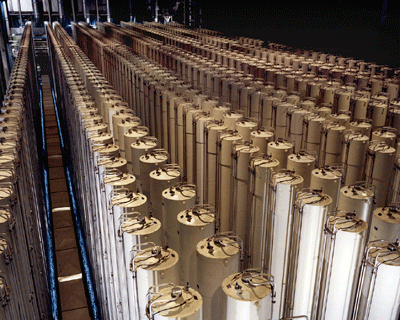|
Auch nach der Katastrophe von Fukushima konnte der Urenco-Konzern
seinen Umsatz und Gewinn mit angereichertem Uran zur Herstellung von Brennelementen
für Kernkraftwerke kräftig erhöhen. Der Marktwert des Unternehmens
wird auf rund zehn Milliarden Euro geschätzt. Er läßt
sich aber nicht so realisieren, wie das die deutschen Miteigentümer
E.ON und RWE gern hätten, um mit dem Verkaufserlös ihre Milliardenlöcher
zu stopfen. Das Urenco-Geschäft basiert nämlich auf einer äußerst
sicherheitsempfindlichen Technologie, mit der auch Atomwaffen hergestellt
werden können. |
Wozu braucht Deutschland angereichertes Uran?
Wenn E.ON und RWE ihre Anteile an Urenco verkaufen,
darf das nicht zu Lasten der Sicherheit gehen
(zu 170103)
Bis Ende 2022 sollen in Deutschland die letzten der 26 Kernkraftwerke vom Netz
gehen, die zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung in Betrieb waren (21 Reaktoren
in der BRD und fünf in der DDR). Damit verabschiedet sich die Stromwirtschaft
endgültig von einer Technologie, die schon immer die gefährlichste, aufwendigste
und teuerste Art war, heißes Wasser für den Betrieb eines Dampfkraftwerks zu
erzeugen. Lange Zeit wollte man das allerdings nicht wahrhaben. Um ein Haar
wäre es sogar zum Einstieg in die sogenannte Wiederaufarbeitung gekommen, und
es bedurfte eines zähen politischen Kampfes, um den bereits begonnenen Marsch
in die Plutoniumwirtschaft zu stoppen (siehe Hintergrund,
Juni 2015).
Nach vollendetem Atomausstieg benötigt die deutsche Stromwirtschaft auch
keine Brennelemente mehr bzw. das angereicherte Uran, mit dem diese bestückt
werden. Die Handvoll Forschungsreaktoren, die es weiterhin gibt, dienen nicht
als Wärmelieferanten, sondern als Neutronenquelle. Sie benötigen dafür
spezielle nukleare Brennstoffe und können mit dem niedrig angereicherten
Uran für die Atomstromerzeugung nichts anfangen. Wie die Auseinandersetzung
um den Forschungsreaktor der TU München gezeigt hat, kann das sogar hochangereichertes
Uran sein, das bis zu 93 Prozent des Isotops U 235 enthält und grundsätzlich
für die Herstellung von Atomwaffen geeignet ist (030411).
Dennoch wird in der westfälischen Stadt Gronau weiterhin Uran zur Verwendung
in Kernkraftwerken angereichert. Die Urenco Deutschland GmbH beliefert damit
eine weltweite Klientel. Zu dieser gehört auch das Brennelemente-Werk des französischen
Areva-Konzerns in Lingen, das nur fünfzig Kilometer von Gronau entfernt ist.
Hier wird ebenfalls weiter produziert. Die Brennstoffversorgung von Kernkraftwerken
bleibt vorerst ein lukratives Geschäft, das im Weltmaßstab betrieben wird und
den Verlust der Nachfrage aus Deutschland verschmerzen kann (siehe Grafik).
Die Gronauer Uranfabrik ist seit 1985 in Betrieb. Ihre Geschichte reicht aber
weiter zurück – bis zum Vertrag von Almelo, der 1970 zwischen der Bundesrepublik,
den Niederlanden und Großbritannien geschlossen wurde. Sie ist die deutsche
Niederlassung des Urenco-Konzerns, der auf der Grundlage dieses Vertrags sowie
der ergänzenden Verträge von Washington (1992), Cardiff (2006) und Paris (2011)
entstanden ist. Dieser internationale Konzern gehört zu jeweils einem Drittel
Großbritannien und den Niederlanden sowie den deutschen KKW-Betreibern E.ON
und RWE. Er macht derzeit von sich reden, weil Großbritannien und die deutschen
Miteigentümer auf eine Privatisierung bzw. den Verkauf ihrer Anteile drängen.
Das wirft große Probleme auf. Zum besseren Verständnis der Problematik ist es
nützlich, zunächst mal einen Blick auf die Geschichte der Urananreicherung zu
werfen und die politischen Umstände zu skizzieren, unter denen der Vertrag von
Almelo zustande kam.
Hochangereichertes Uran war einer von zwei Wegen zur Atombombe
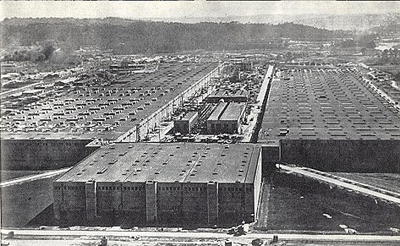 |
Die nach dem Gasdiffusionsverfahren arbeitende Urananreicherung "K
25" in Oak Ridge war seinerzeit das größte Gebäude
der Welt. Hier arbeiteten rund 25.000 Menschen an dem Stoff, mit dem die
Hiroshima-Bombe gebaut wurde.
|
Die Geschichte der Urananreicherung beginnt mit dem Eintritt der USA in den
zweiten Weltkrieg Ende 1941 und dem daraufhin gestarteten "Manhattan-Projekt"
zur Entwicklung der Atombombe. Zur Erreichung dieses Ziels gab es zwei Wege.
Der Ausgangspunkt war in beiden Fällen die Möglichkeit einer Kernspaltung des
Urans durch Beschuß mit Neutronen, die der deutsche Physiker Otto Hahn drei
Jahre zuvor experimentell nachgewiesen hatte.
Im Naturzustand besteht das Element Uran zu mehr als 99 Prozent aus dem nicht
spaltbaren Isotop Uran 238. Nur etwa 0,7 Prozent entfallen auf das Isotop Uran
235, in dem durch Beschuß mit Neutronen eine Kettenreaktion ausgelöst
werden kann. Mit Natururan läßt sich deshalb zwar unter günstigen
Umständen ein entsprechend konfigurierter Reaktor betreiben, aber keine
Atombombe bauen. Um für militärische Zwecke geeignet zu sein, muß
das Mischungsverhältnis der beiden Isotopen zugunsten des Uran 235 verändert
werden. Die USA errichteten zu diesem Zweck in Oak Ridge (Tennessee) gigantische
Anlagen, die den Anteil des spaltbaren Isotops auf bis zu 80 Prozent erhöhten.
Das Ergebnis war die Bombe, die am 6. August 1945 über Hiroshima abgeworfen
wurde.
Parallel zur Urananreicherung in Oak Ridge beschritten die USA in Hanford (Washington)
den anderen Weg, um Atombomben zu produzieren: Er führt über das radioaktive
Element Plutonium. In der Natur kommt dieses Element praktisch nicht vor. Es
entsteht aber beim Betrieb von Reaktoren aus dem Uran der Brennelemente. Dieses
künstlich erzeugte radioaktive Element läßt sich chemisch herauslösen
und für militärische Zwecke verwenden. Zu diesem Zweck errichteten
die USA in Hanford bis Kriegsende drei mit Graphit moderierte Natururan-Reaktoren.
Im Prinzip funktionierten diese wie die späteren Kernkraftwerke. Sie erzeugten
auch Wärme und benötigten deshalb das Wasser des Columbia River zur
Kühlung. Eine Stromerzeugung fand aber nicht statt. Es ging allein um die
Gewinnung von Plutonium. Aus diesem künstlich hergestellten radioaktiven
Element bestand jene Bombe, die am 9. August 1945 über Nagasaki abgeworfen
wurde. (1)
Nazis scheiterten an der Isotopentrennung und setzten auf Plutonium
Die USA unternahmen auch deshalb so große Anstrengungen, weil sie davon
ausgingen, daß Hitlerdeutschland die vorliegenden kernphysikalischen Erkenntnisse
ebenfalls in die Praxis umsetzen werde und dabei womöglich sogar einen
Vorsprung habe. Tatsächlich haben die Nazis und ihre wissenschaftlichen
Helfer ebenfalls den Bau von Atombomben geplant. Schon bei Kriegsbeginn im September
1939 wurde in einer Sitzung des Heereswaffenamtes über die Möglichkeit
und Notwendigkeit einer Vorrichtung diskutiert, um das Uran 235, das sich anscheinend
in besonderen Maße als Kernbrennstoff eigne, vom Uran 238 trennen zu können.
Die Kernphysiker haben daraufhin verschiedene Möglichkeiten der Urananreicherung
erwogen und zum Teil auch ausprobiert.
 |
Amerikaner beim Ausräumen der "Uranmaschine", mit der deutsche
Physiker 1945 in einem Felsenkeller in Haigerloch vergebens versucht hatten,
eine Kettenreaktion in Gang zu bringen. Hauptziel war dabei die Gewinnung
von Plutonium für den Bau einer Atombombe.
|
Dazu gehörte das Trennrohrverfahren, das sich für die Isotopentrennung
bei anderen Gasen bewährt hatte, aber bei Uranhexafluorid versagte. Erfolgreicher
verliefen die Arbeiten an einer "Ultrazentrifuge", mit der es 1943
gelang, eine Anreicherung um etwa fünf Prozent zu erreichen. Das war aber
ein unter großen technischen Schwierigkeiten erzieltes Laborergebnis.
Bis Kriegsende kamen so nur einige hundert Gramm an schwach angereichertem Uran
zustande. Damit ließ sich nicht einmal ein Reaktor betreiben.
Die Nazis kannten indessen auch den zweiten Weg zur Atombombe, der über
das Plutonium führt. Nur der Name des eben erst entdeckten Elements war
ihnen noch nicht geläufig, weil er in den USA geprägt und vorläufig
geheimgehalten wurde. In einem Bericht des deutschen Heereswaffenamtes vom Februar
1942 war stattdessen vom neuen "Element 94" die Rede. Es wurde als
künstliche radioaktive Substanz beschrieben, die von der geplanten "Uranmaschine"
(Reaktor) gewissermaßen als Abfallprodukt erzeugt werde. Mit dieser Substanz
könnten "Kernsprengstoffe" hergestellt werden, "deren Wirkung
die der bisher bekannten Sprengstoffe um viele Zehnerpotenzen übertrifft".
"Unter dem Eindruck dieser Möglichkeit machten sich einige maßgebende deutsche
Physiker den Standpunkt zu eigen, es sei nicht nötig, die direkte Isotopentrennung
besonders zu fördern und zu beschleunigen." So heißt es in einer Darstellung
der Physiker Erich Bagge und Kurt Diebner, die an dem deutschen Atomprojekt
beteiligt waren. "Nach dem Anlauf der Uranbrenner stehe bald ausreichend Plutonium
zur Verfügung, das praktisch als Ersatz für das Uran 235 betrachtet werden könne."
(2a)
Zum Glück hatte das von den Nazis betriebene Atomprojekt einen weit geringeren
Umfang als das der USA und erbrachte bis Kriegsende keine militärisch verwertbaren
Ergebnisse. Da die Urananreicherung vorläufig nicht praktikabel erschien, konzentrierten
die deutschen Physiker ihre Bemühungen auf den Bau eines mit schwerem Wasser
moderierten Natururan-Reaktors. Diese "Uranmaschine" hätte dann das Plutonium
für den Bau von Atomwaffen liefern können. Sie hat aber auch beim letzten Versuch,
der Anfang 1945 in einem Felsenkeller im schwäbischen Städtchen Haigerloch unternommen
wurde, noch nicht funktioniert. Das lag vor allem daran, daß es an genügend
Uran und schwerem Wasser fehlte, um eine Kettenreaktion in Gang zu bringen.
Unter den damaligen Umständen wäre es den Nazis auch gar nicht mehr möglich
gewesen, die weiteren Schritte bis zur Herstellung einer Plutonium-Bombe zu
bewältigen.
Ende April 1945 wurden die in Haigerloch tätigen Physiker von einem Spezialkommando
der US-Armee festgenommen und interniert. Schon vorher dämmerte den Amerikanern,
daß das deutsche Atomprojekt nicht so weit gediehen war, wie sie befürchtet
hatten. Die Hitler-Wehrmacht kapitulierte, bevor die ersten US-Atombomben fertig
waren. Damit erübrigte sich auch der Einsatz der neuen Massenvernichtungswaffe
über deutschen Städten. Japan befand sich dagegen noch im Kriegszustand
mit den USA. Deshalb kam es im August 1945 zu den Bomben-Abwürfen auf Hiroshima
und Nagasaki. (2b)
Zivile Nutzung der Kernenergie blieb mit militärischen Zwecken
und Optionen verbunden
Soviel zur Vorgeschichte der Urananreicherung und der Reaktoren, die nach dem
Krieg zunehmend auch zur Stromerzeugung verwendet wurden. Vorreiter bei der
zivilen Nutzung waren naturgemäß die vorläufig einzigen Atommächte
USA, Sowjetunion und Großbritannien. Zumindest in diesen Ländern
gab es weiterhin eine enge Verbindung zwischen militärischer und ziviler
Nutzung der Kernenergie. Dasselbe galt für Frankreich, das schon unter
der vierten Republik die Atombewaffnung vorbereitete und nach dem Machtantritt
des Präsidenten Charles de Gaulle 1958 offiziell verkündete.
Aber auch andere Länder, die nicht bzw. noch nicht im Besitz von Atomwaffen
waren, sahen im Betrieb von Kernkraftwerken samt der dazugehörigen Industrie
und Forschung zugleich die Offenhaltung einer militärischen Option. Dazu gehörte
die von Konrad Adenauer regierte Bundesrepublik. Der seit 1949 amtierende Bundeskanzler
hatte zwar gleich zweimal den Verzicht seines Landes auf die Herstellung von
atomaren, chemischen oder biologischen Waffen erklärt. Das erste Mal geschah
das mit dem 1952 unterzeichneten Vertrag über die "Europäische Verteidigungsgemeinschaft"
(EVG), der dann an der Ablehnung durch die französische Nationalversammlung
scheiterte. Das zweite Mal gab er diese Erklärung anläßlich der Pariser Verträge
ab, die 1954 das Besatzungsregime aufhoben und die Bundesrepublik zumindest
formal zu einem souveränen Staat machten. Diese Zusicherung war aber lediglich
eine zeitweilige Konzession an die außen- und innenpolitischen Umstände. Ohne
sie wären die Wiederbewaffnung und der Beitritt der Bundesrepublik zur EVG bzw.
NATO gar nicht möglich gewesen.
Führende deutsche Kernphysiker verweigerten öffentlich
ihre Mitwirkung an einer deutschen Atombombe
 |
Nach der Veröffentlichung der "Göttinger Erklärung"
war für Adenauer Schadensbegrenzung angesagt. Das Foto zeigt die
Physiker Otto Hahn, Walther Gerlach und Carl-Friedrich von Weizsäcker
(v.l.n.r) am 19. 4. 1957 auf dem Weg zu einem Gespräch mit der Bundesregierung.
Es endete mit einem nichtssagenden Kommuniqué, wonach die Bundesrepublik
"nach wie vor keine eigenen Atomwaffen produzieren wird".
|
Wie der Adenauer-Biograph Hans-Peter Schwarz feststellt, konnte Adenauer –
anders als de Gaulle in Frankreich oder Macmillan in Großbritannien –
nicht auf einen landesweiten Konsens bei der Kernwaffenpolitik bauen: "Er mußte
froh sein, daß die deutsche Öffentlichkeit die Ausrüstung der Bundeswehr mit
atomaren Trägersystemen tolerierte. Jeder Versuch, Atommacht zu werden, wäre
innenpolitischem Selbstmord gleichgekommen, da dies nicht nur auf seiten der
Sowjetunion, sondern auch im Westen heftigste Gegenbewegung ausgelöst hätte
mit entsprechender Verstärkung der innenpolitischen Ablehnungsfront". In vertrautem
Kreis habe Adenauer indessen keinen Hehl daraus gemacht, daß er die Ängste vor
der Atombombe für übertrieben hielt. Im übrigen habe er sich zurückgehalten
und die Rolle des nach Mitverfügung über Atomwaffen strebenden Scharfmachers
seinem Parteifreund Franz-Josef Strauß überlassen, der ihm zunächst als Atom-
und dann als Verteidigungsminister diente. (3)
An den Verteidigungsminister Strauß richtete sich deshalb auch ein Brief,
in dem 18 führende deutsche Kernphysiker im November 1956 ihre Weigerung
erklärten, an der Herstellung bundesdeutscher Atomwaffen mitzuwirken. Außerdem
kündigten sie die Veröffentlichung des Textes an, falls Strauß
sich nicht von solchen Plänen distanziere. Dieser empfing eine Delegation
der Petenten und beschimpfte sie zunächst: "Ihr Brief enthält
ein Staatsgeheimnis. Jede Veröffentlichung ist strafbar!" Dann bequemte
er sich aber zu der Erklärung, keineswegs eine nationale Kernwaffenherstellung
zu beabsichtigen. Dabei wäre es dann wohl geblieben. Auf einer Pressekonferenz
am 4. April 1957 versuchte Adenauer jedoch, die Ausrüstung der Bundeswehr
mit atomaren Trägerwaffen zu verharmlosen: "Unterscheiden Sie doch
die taktischen und die großen atomaren Waffen", belehrte der Kanzler
die Journalisten. "Die taktischen Waffen sind nichts weiter als die Weiterentwicklung
der Artillerie." Nach dieser Äußerung wollten die Physiker nicht
länger schweigen. So kam jene am 12. April 1957 publizierte "Göttinger
Erklärung" zustande, mit der Otto Hahn, Carl-Friedrich von Weizsäcker,
Werner Heisenberg und andere führende Kernphysiker ihre Mitwirkung an deutschen
Atomwaffen verweigerten (die drei Genannten hatten mit dem Bau der "Uranmaschine"
schon den Nazis zu Diensten sein müssen). In der aktualisierten Fassung
ihrer bisher unveröffentlichten Erklärung warnten die Physiker außerdem
vor Adenauers Verharmlosung der Atomwaffen: "Jede einzelne taktische Atombombe
oder -granate hat eine ähnliche Wirkung wie die erste Atombombe, die Hiroshima
zerstört hat."
Adenauer sah im Atomwaffen-Sperrvertrag einen "Morgenthau-Plan
im Quadrat"
Strauß und seinesgleichen ist es dann doch nicht gelungen, in den Besitz
von Atomwaffen zu gelangen, auch nicht in Kooperation mit Frankreich oder über
den US-Kompromißvorschlag einer "Multilateralen Atomstreitmacht"
(MLF). Das lag vor allem daran, daß sich die beiden Supermächte –
trotz ihrer weiterhin scharfen Konfrontation – ab den sechziger Jahren
darüber einig wurden, eine weitere Ausbreitung von Atomwaffen zu verhindern.
Dieser Konsens zeichnete sich bereits mit dem Atomteststopp-Vertrag ab, den
die USA, die Sowjetunion und Großbritannien 1963 unterzeichneten. Anschließend
verhandelten sie über den Atomwaffensperrvertrag, der im Juli 1968 unterzeichnet
wurde. Schon angesichts der Verhandlungen ließ Ex-Bundeskanzler Adenauer im
Februar 1967 alle diplomatische Rücksichtnahme fallen. In einem Interview mit
dem "Spiegel" erklärte er: "Ich finde diese ganze Sache ungeheuerlich. Das ist
wirklich der Morgenthau-Plan im Quadrat." (4)
Er verglich also den der Bundesrepublik abverlangten Verzicht auf Atomwaffen
mit jener berüchtigten Denkschrift des US-Finanzministers Henry Morgenthau,
der das besiegte Deutschland entindustrialisieren und in mehrere Agrarstaaten
aufteilen wollte. Als die Regierung der sozialliberalen Koalition den Atomwaffensperrvertrag
Ende 1969 unterzeichnete und 1975 dem Bundestag zur Billigung vorlegte, stimmten
noch immer 90 Abgeordnete der Unionsparteien gegen die Ratifizierung.
Die zivile Nutzung der Kernenergie durch die Bundesrepublik setzte sich unter
diesen Umständen dem Verdacht aus, zumindest langfristig auch mit militärischen
Absichten verbunden zu sein, wie das bei Frankreich und Großbritannien
offenkundig der Fall war. (5)
Besonders galt dies für die Urananreicherung und die Gewinnung von Plutonium.
Am Kernforschungszentrum Karlsruhe wurde das sogenannte Trenndüsenverfahren
als neuer Weg zur Isotopentrennung erforscht. Außerdem widmete man sich
dort mit dem Projekt des "Schnellen Brüters" und dem "Institut
für Transurane" in besonderem Maße dem Plutonium. Zu dem Verdacht
paßte ferner, das der nach Atomwaffen lechzende Franz-Josef Strauß
in Bayern den Bau der Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf gegen alle Widerstände
durchzusetzen versuchte, nachdem er von der Bonner Bühne abgetreten und
Ministerpräsident in München geworden war. Zusammen mit dem "Schnellen
Brüter" in Kalkar – dessen Inbetriebnahme nach der Katastrophe
von Tschernobyl ebenfalls verhindert werden konnte – wäre es damit
zum Einstieg der Bundesrepublik in die Plutoniumwirtschaft gekommen.
Das ursprünglich favorisierte Natururan-Konzept wurde nur in
Niederaichbach verwirklicht
 |
In Kahl am Main ging 1960 der erste deutsche Leichtwasser-Reaktor in Betrieb.
Die Anlage wurde noch ganz unbefangen als "Versuchsatomkraftwerk"
bezeichnet. Das Foto zeigt den "Atomminister" Siegfried Balke
bei der Besichtigung. Später war offiziell nur noch von Kernkraftwerken
oder Kernenergie die Rede, und das Atomministerium verwandelte sich in
das Forschungsministerium.
|
Zunächst gab es allerdings noch keine Kernkraftwerke, mit denen sich Anstrengungen
zur Urananreicherung hätten begründen lassen. In den fünfziger Jahren war zwar
viel von den vermeintlichen Segnungen einer friedlichen Nutzung der Kernenergie
die Rede. In der öffentlichen Meinung herrschte sogar eine regelrechte Euphorie,
zumal man außerdem die Kernfusion in greifbarer Nähe glaubte, die bis
heute in den Kinderschuhen steckengeblieben ist (160213).
In Wirklichkeit wußte man wenig vom tatsächlichen Stand der Dinge und von den
Problemen, die mit der neuen Energiequelle verbunden waren. In der Praxis bestanden
selbst in den USA und Großbritannien vorläufig nur bescheidene Ansätze zur Stromerzeugung
mittels Reaktoren. Dabei wurden unterschiedliche Konstruktionstypen ausprobiert,
ohne daß sich eine klare Präferenz zeigte.
Bei den Diskussionen darüber, wie eine zivile Nutzung der Kernenergie durch
die Bundesrepublik bewerkstelligt werden könnte, plädierte die Fachwelt zunächst
mehrheitlich für Natururan-Reaktoren. Sie hatte dabei Großbritannien vor Augen,
das 1956 mit Calder Hall das erste kommerzielle Atomkraftwerk der Welt in Betrieb
nahm und mit derselben Technologie das Plutonium für seine Atomwaffen gewann.
(6) Die Briten betrieben zwar
seit 1952 in Capenhurst auch eine Urananreicherungsanlage nach dem Gasdiffusionsverfahren.
Diese diente aber nur militärischen Zwecken und war so kostspielig, daß sie
eher als Argument gegen die Isotopentrennung taugte.
Natururan-Reaktoren benötigen keine Urananreicherung. Sie verhießen
damit Autarkie bei der Brennstoffgewinnung bzw. die Unabhängigkeit von
US-amerikanischen Lieferungen. Zugleich knüpfte man in Deutschland mit
diesem Konzept an die "Uranmaschine" an, die während des zweiten
Weltkriegs entwickelt worden war. Das galt auch für die Wahl des Moderators:
Im Unterschied zu den Briten, die sich für Graphit entschieden, favorisierte
der neu antretende Reaktorbauer Siemens schweres Wasser. Das Kernkraftwerk Niederaichbach,
mit dessen Bau 1966 begonnen wurde und das 1972 mit einer Leistung von 100 MW
ans Netz des Bayernwerks ging, blieb freilich das einzige dieser Art und galt
schon während seiner Errichtung als überholt. Außerdem war der
Reaktor sehr störanfällig. Er lief nur 18 Tage im Vollbetrieb und
wurde schon 1974 stillgelegt (950814).
Dominanz der USA verhalf Leichtwasser-Reaktor zum weltweiten
Siegeszug
Stattdessen begann sich der Typ des sogenannten Leichtwasser-Reaktors durchzusetzen,
der normales Wasser als Moderator für die Kernspaltung verwendet, aber
angereichertes Uran als Brennstoff benötigt, das zwei bis drei Prozent
des Isotops Uran 235 enthält. Ursprünglich war er für den Antrieb
von Atom-Unterseebooten entwickelt worden. Daß er bald auch bei kommerziellen
Reaktoren dominierte, hatte nichts mit spezifischen Vorzügen für die
Stromerzeugung zu tun, für die sich andere Reaktortypen ebenso oder noch
besser geeignet hätten. Seinen Siegeszug verdankte er vielmehr Kostengesichtspunkten
und der internationalen Dominanz der USA auf diesem Gebiet. (6)
Die Beschaffung des Brennstoffs aus angereichertem Uran war für die USA
kein Problem. Außerdem waren sie bereit, auch ihre Verbündeten mit
ausreichenden Mengen an Brennstoff zu versorgen, wenn diese nun mit dem Bau
von Kernkraftwerken begannen.
So ging dann 1960 mit dem "Versuchsatomkraftwerk" Kahl (15 MW) der
erste deutsche Leichtwasser-Reaktor zur Stromerzeugung in Betrieb. Gebaut wurde
er von der AEG. Die Technik stammte jedoch vom US-Konzern General Electric.
Genauso verhielt es sich mit den Siedewasser-Reaktoren Gundremmingen (237 MW)
und Lingen (240 MW), die 1966 und 1968 ans Netz gingen. Siemens hatte inzwischen
ebenfalls das Leichtwasser-Konzept übernommen und errichtete mit einer
Lizenz des US-Konzerns Westinghouse in Obrigheim den ersten deutschen Druckwasserreaktor
(340 MW), der von 1968 bis 2005 in Betrieb war (050503).
Der Brennstoff für diese Reaktoren kam ebenfalls aus den USA. Die Grundlage
dafür bildete ein 1957 zwischen den Regierungen in Washington und Bonn
geschlossenes Abkommen "über Zusammenarbeit auf dem Gebiet der zivilen
Verwendung der Atomenergie". Die Bundesrepublik konnte nun bis zu 2500
Kilo Uran mit einer Anreicherung bis zu 20 Prozent pachten oder kaufen. Außerdem
durfte sie bis zu sechs Kilo hochangereichertes Uran für einen Materialprüfreaktor
erwerben.
In den siebziger Jahren gingen dann zehn weitere Leichtwasser-Reaktoren mit
einer Leistung von insgesamt 8286 MW (netto) ans Netz. Aber auch jetzt kam für
die Bundesrepublik eine eigene Urananreicherung schon finanziell nicht in Frage.
Das einzig praktikable Verfahren war nämlich bis dahin die Gasdiffusion, bei
der das Isotopengemisch des Natururans in Form von Uranhexafluorid-Gas mit großen
Kompressoren durch feinporige Membranen gepreßt wird. Dieses Verfahren war ungemein
energieaufwendig und teuer. Außerdem war es nur dann einigermaßen wirtschaftlich,
wenn es in ganz großem Maßstab angewendet wurde, wie in den USA. Bei voller
Auslastung verschlangen die Gasdiffusionsanlagen der USA zu Anfang der sechziger
Jahre 56 Milliarden Kilowattstunden, was fast der Hälfte des bundesdeutschen
Stromverbrauchs entsprach. Mit einer Kapazität von jährlich 17.000 Tonnen Uran-Trennarbeit
(UTA) verfügten die USA über ein Quasi-Monopol bei angereichertem Uran und konnten
so auch die Preise auf dem Weltmarkt bestimmen. (7)
Deutschland, Holland und England vereinbarten 1970 die Entwicklung
des Zentrifugenverfahrens
Theoretisch gab es noch andere Möglichkeiten der Isotopentrennung wie
das Zentrifugenverfahren, das Trenndüsenverfahren, die elektromagnetische
Trennung, die Isotopenschleuse oder die Thermodiffusion. Die größten
Aussichten schien am Ende das Zentrifugenverfahren zu bieten. Dabei wird Uranhexafluorid-Gas
in einen länglichen Zylinder geleitet, der möglichst reibungsarm gelagert
ist und sich mit unvorstellbar hoher Geschwindigkeit innerhalb eines Vakuums
dreht. Infolge der Zentrifugalkraft sammeln sich die schwereren Moleküle
des Uran 238 mehr am Rand und die leichteren des Uran 235 mehr in der Mitte
des Zylinders an. Zugleich wird innerhalb des Zylinders eine thermische Konvektionsbewegung
erzeugt, welche das angereicherte Uran am oberen und das abgereicherte Uran
am unteren Ende konzentriert. Durch kaskadenartiges Hintereinanderschalten solcher
Zylinder wird der Prozeß solange wiederholt, bis die gewünschte Anreicherung
erreicht ist. Das Zentrifugenverfahren benötigt nur einen Bruchteil der
Energie, die für das Gasdiffusionsverfahren aufgewendet werden muß.
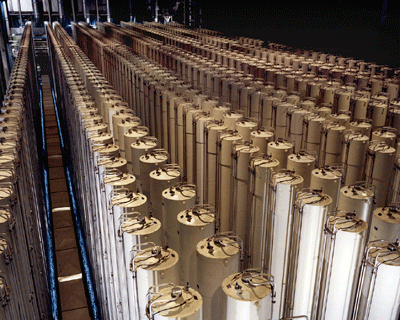 |
Uran-Zentrifugen sind längliche Zylinder, die mit Uranhexafluorid
gefüllt werden und mit unvorstellbarer Geschwindigkeit im Vakuum rotieren.
Das leichtere Uran 235 konzentriert sich dabei am oberen Ende und
das schwerere U 238 am unteren Ende.
|
Neben größerer Wirtschaftlichkeit der Urananreicherung hätte
das Zentrifugenverfahren größere Unabhängigkeit von US-Lieferungen
beschert. Seine Entwicklung bis zur Anwendungsreife und bis zum Beweis der wirtschaftlichen
Überlegenheit war aber ein Kraftakt, den sich kein europäisches Land
allein zumuten wollte. Die Bundesrepublik verhandelte deshalb seit 1968 mit
den Niederlanden und Großbritannien über ein gemeinsames Projekt.
Die niederländische Atomkommission hatten schon in den fünfziger Jahren
einen Vorstoß für eine deutsch-holländische Zusammenarbeit bei
der Zentrifugenentwicklung unternommen. Nun kamen noch die Briten hinzu, weil
sie das Zentrifugenverfahren für aussichtsreicher hielten als die in Capenhurst
praktizierte Gasdiffusion und auf diese Technologie umsteigen wollten. Am 4.
März 1970 vereinbarten die drei Staaten eine enge Zusammenarbeit "zur
Anwendung des Gaszentrifugenverfahrens auf industrieller und kommerzieller Grundlage".
Der Vertrag wurde in der niederländischen Stadt Almelo unterzeichnet, die
bereits als Standort der niederländischen Urananreicherung vorgesehen war.
Der Bundestag ratifizierte ihn am 24. Juni 1971 einstimmig und ohne Debatte.
Anschließend wurde er in allen drei Sprachen im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.
Auf der Grundlage dieses Vertrags von Almelo, mit dem sich die beteiligten
drei Staaten weitreichende Kontrollbefugnisse und Vorbehaltsrechte sicherten,
entstand dann die Urenco als privatrechtlich organisiertes kommerzielles Unternehmen.
Zuerst wurden ab 1979 in Almelo und Capenhurst Pilotanlagen und jeweils eine
industrielle Demonstrationsanlage mit einer Kapazität von 200 Tonnen Urantrennarbeit
jährlich (UTA/a) errichtet. Dann folgten reguläre Anlagen, die bis
Ende 1985 eine Kapazität von 800 UTA/a in Almelo und von 650 UTA/a in Capenhurst
erreichten. Die Nutzung des deutschen Standortes Gronau begann mit der Errichtung
eines Montagewerks für Zentrifugen, die seit 1980 von der M.A.N. Uranit
Gronau GmbH installationsfertig zusammengebaut wurden. 1982 wurde dann auch
hier mit dem Bau einer Urananreicherungsanlage begonnen, die 1985 in Betrieb
ging und bis 1988 eine Kapazität von 400 UTA/a erreichen sollte. (8)
Frankreich wollte keine deutsche Beteiligung an seinen Gasdiffusionsanlagen
Bevor sich die Bundesregierung für die Zusammenarbeit mit Großbritannien
und den Niederlanden zur Entwicklung des Zentrifugenverfahrens entschied, hatte
sie mehrfach in Paris angefragt, ob eine deutsche Beteiligung an den französischen
Gasdiffusionsanlagen möglich sei. Wie aus den Akten des Auswärtigen
Amts hervorgeht, blieben diese Vorstöße aber vergebens, "da
Präsident de Gaulle die Preisgabe jeglicher technischer Informationen über
das Diffusionsverfahren an Deutschland untersagt hatte". Auch das Projekt
einer gemeinsamen Anlage der EG-Staaten sei deshalb gescheitert.
Ein paar Monate später zeigte sich der französische Präsident de Gaulle aber
doch bereit, auf dieses Angebot einzugehen: Bei einem Gespräch, das am 13. März
1969 in Paris stattfand, erklärte er dem Bundeskanzler Kiesinger, daß das in
Pierrelatte (Tricastin) mit dem Gasdiffusionsverfahren angereicherte Uran zwar
für die "Force de frappe" ausreiche, nicht aber für den geplanten Ausbau der
atomaren Stromerzeugung. Frankreich habe deshalb der Bundesrepublik eine Beteiligung
an diesen Anreicherungsanlagen und dem damit erzeugten Uran angeboten. Dann
seien aber plötzlich die Engländer gekommen und hätten den Deutschen gesagt,
das Gaszentrifugenverfahren sei weitaus besser und man müsse nun schnell in
Holland eine entsprechende Anlage bauen. Wie aus den Akten weiter hervorgeht,
wußten bis dahin von einem solchen Angebot allerdings weder Kiesinger noch irgendwelche
Mitarbeiter der Bundesregierung. (9)
Über dieselbe Geschichte berichtet Bertrand Goldschmidt, ein führendes
Mitglied der französischen Atomaufsichtsbehörde CEA, in seinem 1980 erschienenen
Buch "Le Complexe atomique": Demnach gab de Gaulle schließlich doch grünes Licht
für die anfangs verweigerte Zusammenarbeit und schickte seinen Verteidigungsminister
Galley nach Bonn, damit er dem deutschen Kollegen Stoltenberg die Errichtung
einer grenzüberschreitenden gemeinsamen Gasdiffusionsanlage am Rhein vorschlage
(anscheinend war das Laufwasserkraftwerk Iffezheim gemeint, das aufgrund eines
1969 geschlossenen deutsch-französischen Staatsvertrags errichtet wurde). Der
auf französischer Seite gelegene Teil sollte dabei aus militärischen Gründen
der Geheimhaltung unterliegen. Die Hoffnung auf eine deutsche Zusage habe sich
dann aber vierzehn Tage später mit der Antwort Stoltenbergs zerschlagen.
(10)
Euratom-Vertrag taugte nicht als rechtliche
Grundlage
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, weshalb das Urananreicherungsunternehmen
Urenco nicht auf Grundlage des Euratom-Vertrags zustande kam, der eigentlich
für derartige gemeinsame Projekte der zivilen Nutzung und Erforschung der
Kernenergie gedacht war. Dieser Vertrag war schon im März 1957 zusammen
mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) aus der Taufe gehoben
worden und ab 1958 in Kraft getreten. Ähnlich dem Vertrag über die
Montanunion, der schon 1952 in Kraft getreten war, sollte er die spätere
Entwicklung der EWG zur Europäischen Gemeinschaft (1993 - 2009) und zur
Europäischen Union (seit 2009) auf einem speziellen Gebiet ein Stück
weit vorwegnehmen. Neben dem "gemeinsamen Markt auf dem Kerngebiet"
– so die Überschrift von Kapitel 9 – gehörte dazu die
gemeinsame Beschaffung von Kernbrennstoffen (Kapitel 6) oder die Gründung
gemeinsamer Unternehmen auf dem Gebiet der Kernenergie (Kapitel 5). Weitere
Bestimmungen befaßten sich mit Geheimhaltungsvorschriften, der Kontrolle
des radioaktiven Materials oder gemeinsamen Forschungsanstrengungen.
Die gemeinsame Urananreicherung wäre unter die Kapitel 5 und 6 dieses
Vertrags gefallen. Stattdessen wurde der Vertrag von Almelo geschlossen, in
dem der Euratom-Vertrag nur beiläufig erwähnt wurde. Dies hatte zwei
Gründe: Zum einen verhandelte Großbritannien damals noch über
den Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und wurde erst ab
1973 deren Mitglied. Noch wichtiger dürften jedoch die Rivalitäten
und das Mißtrauen zwischen den EWG-Staaten gewesen sein, die hauptsächlich
auf den fließenden Übergang zwischen militärischer und ziviler
Nutzung der Kernenergie zurückzuführen waren.
Bei der Lektüre des Euratom-Vertrags fällt auf, daß er zwar
offenbar auf die friedliche Nutzung der Kernenergie zielt, dies aber keineswegs
explizit festhält. Das kam nicht zufällig, sondern hatte mit der nuklearen
Doppelrolle Frankreichs zu tun. Es war von Anfang an eine Illusion, die militärische
und die zivile Nutzung der Kernenergie säuberlich voneinander trennen zu
können. Der Vertrag hat deshalb nie jene Bedeutung erlangt, die ihm scheinbar
zukam. Die beabsichtigte Zusammenarbeit scheiterte regelmäßig, sobald
divergierende nationale Interessen ins Spiel kamen. Stattdessen hat die EU-Kommission
immer mehr Kompetenzen auf dem Gebiet der Kernenergie gefordert und auch erhalten.
Soweit der Vertrag doch zum Tragen kam, bei Forschungsaktivitäten oder
den Krediten für die Nachrüstung der osteuropäischen Kernkraftwerke
(040103), führte er ein Scheinleben von Gnaden
der Kommission.
|
|
Im Jahr 2005 genehmigte die rot-grüne
Landesregierung von Nordrhein-Westfalen den weiteren Ausbau der Urenco-Anlage
in Gronau (blau) und die Errichtung einer Lagerhalle für bis zu
60.000 Tonnen Uranoxid (braun). Das Bauschild läßt die Ausdehnung
der Anlage erkennen. |
|
Frankreichs alte Urananreicherung "Eurodif"
in Tricastin (Gebäude im Vordergrund) verbrauchte den größten
Teil des Stroms, der mit den vier Reaktoren des Kernkraftwerks (links
im Hintergrund) erzeugt wurde. Sie wurde ab 2010 durch Zentrifugen von
Urenco ersetzt. |
Aus der Koordinations-Gesellschaft Urenco wurde 1993 eine Konzernholding
Zunächst betrieben die drei Urenco-Gesellschafter ihre jeweiligen Urananreicherungsanlagen
in Almelo, Capenhurst und Gronau selbständig. In Gronau war das die Uranit
GmbH, an der die PreussenElektra AG und die RWE-Tochter Nukem GmbH mit jeweils
37,5 Prozent sowie die Hoechst AG mit 25 Prozent beteiligt waren. Die Anlage
in Almelo unterstand der Ultra Centrifuge Nederland N.V. und damit dem niederländischen
Staat. In Capenhurst führte mit der British Nuclear Fuels (BNFL) ebenfalls
ein reines Staatsunternehmen die Regie. Außerdem gab es in Großbritannien
die "Urenco Ltd", die 1971 für das gemeinsame Marketing und Koordinationsaufgaben
gegründet worden war.
Aus dieser "Urenco Ltd" wurde dann 1993 eine Holding, in welche die
Gesellschafter ihre drei Anreicherungsbetriebe einbrachten. Die neue Holding
übernahm ferner die Beteiligungen an der Centec GmbH, die 1971 als Spezialunternehmen
für den Bau von Zentrifugen mit Sitz in Deutschland gegründet worden
war. Die niederländischen und britischen Gesellschafter der Centec waren
dieselben wie bei der Urenco. Den deutschen Anteil hielt die in Bergisch-Gladbach
ansässige Gesellschaft für nukleare Verfahrenstechnik mbH, die jeweils
zur Hälfte dem Reaktorbauer Interatom (Siemens) und dem Maschinenbaukonzern
MAN gehörte. (11)
Zentrifugen-Tochter ETC gehört seit 2006 zur Hälfte der Areva
An der Centec-Nachfolgerin "Enrichment Technology Company Ltd" (ETC)
beteiligte sich dann 2006 der französische Atomkonzern Areva 2006 zur Hälfte.
Diese nachträgliche Einbeziehung Frankreichs in den Almelo-Vertrag kam
mit dem Vertrag von Cardiff zustande, den die Bundesrepublik, die Niederlande,
Großbritannien und Frankreich im Juni 2006 abschlossen und der nach seiner
Billigung durch den Bundestag ebenfalls im Bundesgesetzblatt veröffentlicht
wurde. Den Hintergrund bildete dabei, daß Frankreich sich von dem energieaufwendigen
Gasdiffusionsverfahren verabschieden wollte, mit dem es bisher die Urananreicherung
für zivile und militärische Zwecke betrieb. Die Gasdiffusionsanlage
Eurodif im Kernkraftwerk Tricastin (3.280 MW) verschlang nämlich zwei Drittel
von dessen Stromproduktion (080705). Die neue Zentrifugenanlage,
die von der Urenco-Tochter ETC in Tricastin errichtet wurde und ab 2010 in Betrieb
ging, verbrauchte dagegen für dieselbe Trennarbeit nur fünf Prozent
der früheren Strommenge.
Seit 2010 produziert Urenco auch in den USA
Die USA waren ebenfalls an der von Urenco entwickelten Zentrifugentechnik interessiert,
denn mit ihren Gasdiffusionsanlagen gerieten sie preislich immer mehr ins Hintertreffen.
Im Juli 1992 kam es deshalb zwischen den Almelo-Staaten und den USA in Washington
zu einem Vertrag "über die Errichtung, den Bau und den Betrieb einer
Urananreicherungsanlage in den Vereinigten Staaten von Amerika", der zwei
Jahre später vom Bundestag gebilligt und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht
wurde. Nach dem Einstieg der Areva bei der Urenco-Tochter ETC wurde dieser Vertrag
durch ein weiteres Übereinkommen ergänzt, das Frankreich miteinbezog
und im Februar 2011 in Paris zustande kam.
Es dauerte allerdings bis 2010, ehe die Zentrifugenanlage bei Eunice im US-Bundesstaat
New Mexico den Betrieb aufnahm. Mit einer Kapazität von jährlich 4.600 Tonnen
UTA (Uran-Trennarbeit) rangierte sie 2015 vor der Anlage in Gronau (4.100 t),
aber hinter Almelo (5.100 t) und Capenhurst (4.900 t). Die neue "Urenco USA
Inc" wurde wie die Zentrifugen-Sparte ETC zu einer direkten Tochter der Holding.
Die drei Urananreicherungen in Europa, die dem Vertrag von Almelo unterliegen,
hat man dagegen in der "Urenco Enrichment Company Ltd" zusammengefaßt und über
diese an die Dachgesellschaft angebunden. Der Gesamtkonzern gehört bis heute
über Staatsunternehmen zu jeweils einem Drittel der britischen bzw. der niederländischen
Regierung. Das restliche Drittel hält die Uranit GmbH, an der jeweils zur Hälfte
die deutschen Energiekonzerne E.ON und RWE beteiligt sind.
Für E.ON und RWE hat die Beteiligung keine strategische Bedeutung
mehr
Diese Konstruktion soll nun allerdings geändert und soweit wie nur möglich
privatisiert werden. Schon kurz nach der Katastrophe von Fukushima gab es Gerüchte,
daß E.ON und RWE ihre Beteiligungen verkaufen wollten. Das klang auch plausibel:
Die Urananreicherung ist zwar weiterhin ein rentables Geschäft. Für die beiden
deutschen Energiekonzerne hat sie aber, wie das gesamte Nukleargeschäft, ihre
frühere strategische Bedeutung verloren. Zugleich könnten beide Konzerne den
Verkaufserlös gut gebrauchen: Als Ersatz für die Milliarden, die sie mit ihrer
jahrelangen Fixierung auf Atom- und Kohlestrom verbrannt haben (siehe Hintergrund,
Oktober 2013).
Auf Nachfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag behauptete die schwarz-gelbe
Bundesregierung am 1. Dezember 2011, daß ihr nichts von derartigen Verkaufsabsichten
bekannt sei. Wenig später berichteten aber verschiedene Medien, daß
auch Großbritannien und die Niederlande ihre Anteile verkaufen wollten.
Die drei Urenco-Gesellschafter hätten sogar potentielle Käufer zur
Abgabe von unverbindlichen Angeboten eingeladen und würden sich einen Marktwert
zwischen acht und zwölf Milliarden Euro erhoffen.
Aus staatlicher Sicht ist die Sicherheit allemal wichtiger
als der mögliche Verkaufserlös
Die mittlerweile schwarz-rote Bundesregierung räumte am 22. Dezember 2014
ein, "daß ein Markttest durchgeführt wird". Damit wollten
die Anteilseigner prüfen, wie groß das Interesse möglicher Erwerber
wäre. In ihrer Antwort auf eine Anfrage der Linken versicherte sie zugleich,
daß es noch nicht um Verkaufsgespräche gehe. Änderungen der
Anteilsstruktur werde sie nur dann zustimmen, wenn "auch weiterhin nukleare
Nichtverbreitung, Sicherung der Technologie und wirtschaftliche Solidität
bei Urenco sichergestellt sind". Ähnlich äußerte sich Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel am 15. Januar 2015 in seiner Antwort auf eine Nachfrage der grünen
Abgeordneten Sylvia Kotting-Uhl.
Zumindest will die Bundesregierung nicht zulassen, daß die Urenco wie
ein normales Unternehmen an die Börse gebracht wird. Das ergibt sich aus
ihrer jüngsten Antwort auf eine weitere parlamentarische Anfrage der Linken,
die vom 28. Dezember 2016 datiert ist. Demnach verhandelt sie "seit mehreren
Jahren mit Großbritannien und den Niederlanden über eine von Großbritannien
initiierte Anteilsveräußerung/Privatisierung". Vor allem gehe
es dabei um die Sicherung der "hoheitlichen nichtverbreitungspolitischen
SANP-Rechte (SANP = Security and Non-Proliferation)".
 |
Eine Inspektorin der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO)
überprüft Behälter mit Uranhexafluorid in der niederländischen
Anlage Almelo. |
Pakistan kam mit Hilfe eines früheren Urenco-Mitarbeiters zu Atomwaffen
Im Klartext: Es soll verhindert werden, daß weitere Länder oder
sogar verbrecherische Organisationen wie der "Islamische Staat" über
das Eigentum an Urenco in den Besitz von Atomwaffen gelangen. Noch unvergessen
ist, welche Rolle Urenco einst spielte, als Pakistan Anfang der achtziger Jahre
in den Klub der inoffiziellen Atommächte aufrückte, dem auch Israel,
Indien und Nordkorea angehören. Das dafür nötige Knowhow lieferte
der Wissenschaftler Abdul Kadir Khan, der zuvor bei Urenco an der Entwicklung
von Zentrifugen beteiligt war. Pakistan soll bei bei diesem Coup von Saudi-Arabien,
den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Irak und Lybien finanziell unterstützt
worden sein. An solchen Geldquellen würde es auch heute nicht fehlen, um
einen Konzern wie Urenco aus anderen als rein geschäftlichen Gründen
zu erwerben.
Die rund zehn Milliarden Euro, welche die Anteilseigner mit dem Verkauf ihrer
Urenco-Anteile zu erlösen hoffen, setzen offenbar voraus, daß das
Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und an die Börse gebracht
wird. Jedenfalls hat man zunächst darüber verhandelt. Es wurde indessen
"keine tragfähige und für alle drei Staaten akzeptable rechtliche
(SANP-)Struktur gefunden", wie es in der Antwort der Bundesregierung heißt.
Die Möglichkeit eines Börsengangs sei deshalb ab Mitte 2016 nicht
weiter verfolgt worden.
Die deutschen Miteigentümer E.ON und RWE scheinen es nun für sinnvoller
zu halten, weiterhin ihre Gewinnanteile einzustreichen, anstatt Auflagen für
einen Umbau des Konzerns zu akzeptieren, die den erhofften Verkaufserlös
schmälern würden. Das ist noch immer besser, als wenn dem "Islamischen
Staat" die Gelegenheit geboten würde, über Strohmänner Aktienpakete
an Urenco zu erwerben, aber keine befriedigende Lösung. Schließlich
hat Deutschland den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen. Die Gronauer Anlage
gehört zwar nicht zu den Kernkraftwerken, aber zu den notwendigen Voraussetzungen
für deren Betrieb. Sie paßt damit nicht mehr in die energiepolitische
Landschaft.
Abgereichertes Uran ist kein "Wertstoff", sondern radioaktiver
Müll
Außerdem handelt es sich um keine normale Geschäftstätigkeit,
sondern um den Umgang mit radioaktiven Stoffen, der nur mit besonderer behördlicher
Genehmigung und Überwachung erlaubt ist. Es geht dabei nicht nur um die
320.890 Tonnen angereichertes Uran, die von 2011 bis 2016 in Gronau erzeugt,
gelagert und in alle Welt verschickt wurden. Ein weiteres Problem ist das abgereicherte
Uran, das dabei anfällt. Bereits vor zehn Jahren geriet die Urenco in die
Kritik, weil sie diesen radioaktiven Abfall als angeblichen Wertstoff nach Sibirien
verschickte. Dort sollte er angeblich wieder so angereichert werden, daß
sein Isotopengemisch dem von Natururan entspricht. In Wirklichkeit dürfte
das aber nur ein Vorwand gewesen sein, um die Abfälle außer Landes
zu schaffen und auf russischen Atommüllkippen loszuwerden (091006).
Nach Angaben der Bundesregierung standen zum 13. Mai 2016 auf dem Freigelände
des Gronauer Werks 18.531 Tonnen abgereichertes Uranhexafluorid herum. Im Grunde
ist das radioaktiver Müll, obwohl Urenco vorgibt, es handele sich um einen
"Wertstoff", der bis zu seiner möglichen Wiederverwendung nur
zwischengelagert werde. Im gasförmigen Zustand ist diese Uran-Lagerung
auf Dauer besonders riskant. Urenco hat deshalb schon einen Großteil des
Uranhexafluorids nach Frankreich geschickt, um es in Uranoxid umwandeln zu lassen.
In dieser Form gelangt es nach Gronau zurück, um dort weiter auf den St.
Nimmerleinstag seiner Neuverwendung zu warten.
Sowohl der Almelo-Vertrag als auch Euratom passen nicht zur
Energiewende
Das ganze Vertragsgeflecht um die Urenco, das mit dem Abkommen von Almelo sowie
den Erweiterungsverträgen mit Frankreich und den USA geschaffen wurde,
diente der Förderung der Kernenergie. Es kann deshalb nicht mehr zeitgemäß
sein, nachdem einer der Vertragspartner sich für den Ausstieg aus dieser
hochriskanten, teuren und mit immensen Ewigkeitslasten behafteten Art der Dampferzeugung
entschieden hat. Vorläufig ist das nur Deutschland. Aber auch in den Niederlanden
gibt es zumindest keine Neubaupläne, und die von Großbritannien betriebene
Privatisierung stößt hier auf große Vorbehalte.
In den Niederlanden ist sowieso nur noch der Reaktor Borssele mit seiner bescheidenen
Leistung von 482 MW in Betrieb. Vor acht Jahren hat der Urenco-Miteigenümer
RWE versucht, mit dem Essent-Konzern auch die Mehrheit an diesem Kernkraftwerk
zu übernehmen. Er scheiterte daran, daß der Betrieb von Kernkraftwerken
nach niederländischem Recht nur Unternehmen der öffentlichen Hand
gestattet ist (110512). Falls sich die öffentliche
Hand zur vorzeitigen Stillegung von Borssele entschließen sollte, würde
der Vertrag von Almelo auch für die Niederlande obsolet. Dann würde
von den drei Almelo-Partnern nur noch Großbritannien unentwegt auf die
Kernenergie setzen, obwohl der so erzeugte Atomstrom deutlich höher subventioniert
werden muß als hierzulande die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
(siehe Hintergrund, September 2016).
Nicht mehr zeitgemäß ist auch der Euratom-Vertrag. Seit dem Vertrag
von Lissabon, der Ende 2009 in Kraft trat und der EU-Kommission eine breit angelegte
Zuständigkeit in der Energiepolitik übertrug, gehört er endgültig
zum Totholz innerhalb des europarechtlichen Gestrüpps aus Verträgen,
Richtlinien und Verordnungen. Im Unterschied zum Vertrag über die Montanunion,
der bis 2002 befristet war, läuft er aber nicht automatisch aus. Man müßte
ihm deshalb ein gnädiges Ende bereiten. – Vor allem deshalb, weil
sein Grundanliegen die Förderung der Kernenergie war und noch immer ist.
In seiner Präambel wird die Kernenergie als "unentbehrliche Hilfsquelle
für die Entwicklung und Belebung der Wirtschaft und für den friedlichen
Fortschritt" bezeichnet. Das paßt zur Energiewende wie die Faust
aufs Auge.
Literaturhinweise:
(1) Robert Jungk, Heller als tausend Sonnen – das Schicksal der Atomforscher,
Scherz & Goverts, Stuttgart 1956
(2a) Bagge/Diebner/Jay, Von der Uranspaltung bis Calder Hall, Rowohlt Taschenbuch
Verlag, Hamburg 1957
(2b) Mark Walker, Die Uranmaschine – Mythos und Wirklichkeit der deutschen
Atombombe, Siedler Verlag, Berlin 1990
(3) Hans-Peter Schwarz, Adenauer und die Kernwaffen, Vierteljahreshefte für
Zeitgeschichte, München 1989, Heft 4 (im Internet
abrufbar)
(4) Der Spiegel, 1967 Nr. 10 (im Internet
abrufbar)
(5a) Roland Kollert, Atomtechnik als Instrument westdeutscher Nachkriegs-Außenpolitik,
VDW-Materialien 1/2000 (im Internet
abrufbar)
(5b) Matthias Küntzel, Bonn und die Bombe – Deutsche Atomwaffenpolitik
von Adenauer bis Brandt, Campus Verlag, Frankfurt/M. 1992 (im Internet
abrufbar)
(5c) Udo Leuschner, Baut Bonn an der Atombombe?, Blätter für deutsche und internationale
Politik, März 1964
(6) Joachim Radkau, Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft 1945 -
1975, Rowohlt Taschenbuch, Hamburg 1983
(7) Wolfgang D. Müller, Geschichte der Kernenergie in der Bundesrepublik
Deutschland, Anfänge und Weichenstellungen, Schäffer-Poeschel Verlag,
1990
(8) Hans Michaelis (Hg.), Handbuch der Kernenergie (2 Bd.), Econ, 1986
(9) Akten zur auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland, Band
2, Verlag Oldenbourg, München 1997, S. 383
(10) Bertrand Goldschmidt, Le Complexe atomique, Fayard Paris 1980, S. 388
- 390
(11) Hans Michaelis/Carsten Salander (Hg.), Handbuch Kernenergie, VWEW, Frankfurt
am Main 1995