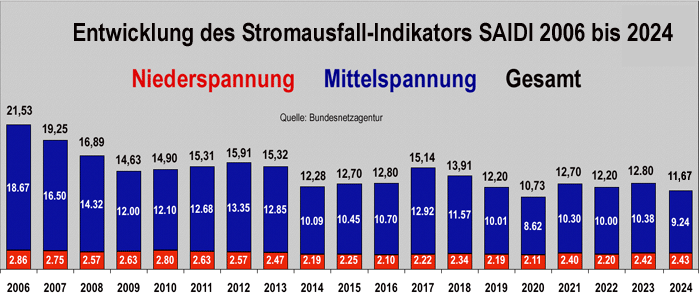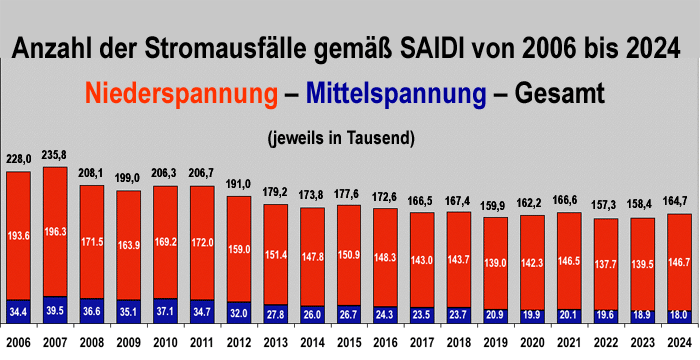|
| Mit einer durchschnittlichen Stromausfall-Dauer von 11,67 Minuten
pro Letztverbraucher ist der SAIDI-Wert des Jahres 2024 bisher der zweitbeste.
Allerdings werden nur Stromausfälle erfasst, die länger als drei Minuten
dauern. Im Durchschnitt der jeweils letzten zehn Jahre sank die Dauer
solcher Unterbrechungen, die 2015 noch 15,9 Minuten betrug, von Jahr zu
Jahr kontinuierlich bis auf gegenwärtig 12,5 Minuten. |
Stromausfälle nahmen zwar um vier Prozent zu, konnten aber
schneller behoben werden
Die Bundesnetzagentur veröffentlichte am 9. Oktober die neuesten Zahlen zu
Unterbrechungen der Stromversorgung im Jahr 2024. Demnach übermittelten 830
Netzbetreiber insgesamt 164.645 Versorgungsunterbrechungen in der Nieder- und
Mittelspannung, die länger als drei Minuten dauerten (nur solche werden vom
Stromausfallindikator SAIDI erfasst). Die Anzahl der Störungsmeldungen hat damit
gegenüber dem Vorjahr um etwa 6.300 Meldungen oder vier Prozent zugenommen (siehe
Grafik 2). Trotzdem hat sich 2024 die durchschnittliche
Dauer der Stromausfälle je Letztverbraucher leicht verringert: Da sie schneller
behoben werden konnten, vergingen bis zur Beseitigung der Störung nur noch 11,68
Minuten, während es im Jahr zuvor 12,80 Minuten waren (siehe Grafik
1).
Außer der Mindestdauer von mehr als drei Minuten müssen die Unterbrechungen
auf Einwirkungen Dritter, auf Rückwirkungen aus anderen Netzen oder auf andere
Störungen im Bereich des Netzbetreibers zurückzuführen sein. Geplante Unterbrechungen
und Ausfälle aufgrund höherer Gewalt bleiben ebenso außer Betracht wie Spannungs-
und Frequenzschwankungen, die ebenfalls die Versorgungsqualität beeinträchtigen
können.
Aus allen ungeplanten Unterbrechungen, die nicht auf Ereignisse der höheren
Gewalt zurückzuführen sind, ermittelt die Bundesnetzagentur den sogenannten
System Average Interruption Duration Index (SAIDI), der die durchschnittliche
Versorgungsunterbrechung je angeschlossenem Letztverbraucher innerhalb eines
Kalenderjahres widerspiegelt. Neben den Kennzahlen zu Unterbrechungen der Stromversorgung
je Bundesland wird eine anonymisierte Liste der Störungsmeldungen veröffentlicht.
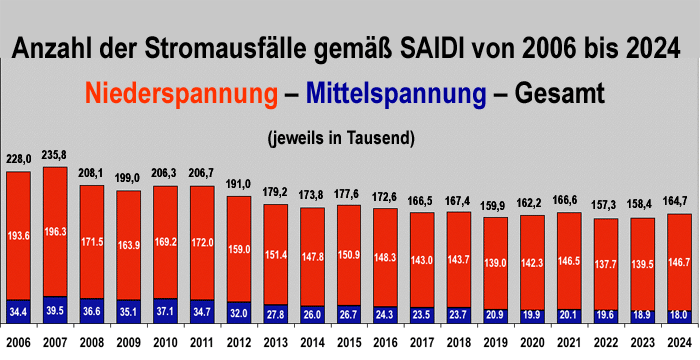 |
| Diese Grafik verdeutlicht, dass die meisten Stromausfälle ihre Ursache
zwar im Mittelspannungsnetz haben, (siehe Grafik 1),
dort aber nur vergleichsweise wenige Letztverbraucher treffen, die einen
besonders hohen Strombedarf haben und deshalb direkt an eine Ebene zwischen
Niederspannung (bis 1000 Volt) und weniger als 100 Kilovolt ("Hochspannung"
des Verteilnetzes) angeschlossen sind. Zahlenmäßig vielfach stärker betroffen
sind die Letztverbraucher von Haushalten und Gewerbe der nachgelagerten
Niederspannungsnetze. |
Amtliche Erhebung löste freiwillige Störungsstatistiken ab
Bis 2005 ermittelten die deutschen Netzbetreiber die Versorgungsqualität auf
freiwilliger Basis, zunächst ab 1994 in der "VDEW Störungs- und Schadensstatistik"
und ab 2004 in der "VND Störungs- und Verfügbarkeitsstatistik". Seit Inkrafttreten
des neuen Energiewirtschaftsgesetzes im Juli 2005 müssen die Netzbetreiber gemäß
§ 52 EnWG der Bundesnetzagentur bis
zum 30. Juni eines Jahres einen Bericht über alle in ihrem Netz im letzten Kalenderjahr
aufgetretenen Versorgungsunterbrechungen vorlegen. Unter anderem ist die durchschnittliche
Versorgungsunterbrechung in Minuten je Letztverbraucher anzugeben. Die Anreizregulierungsverordnung
wiederum sieht vor, daß die so ermittelte Versorgungsqualität nach §
21 ARegV einer der Maßstäbe für die Höhe der Investitionen ist, die der
Netzbetreiber zu tätigen hat.
Bericht zur Versorgungssicherheit hält Zubau von bis zu 22,4 GW steuerbaren
Kapazitäten für erforderlich - schlimmstenfalls sogar bis zu 35,5 GW
Am 3. September veröffentlichte die Bundesregierung den "Bericht zu Stand
und Entwicklung der Versorgungssicherheit im Bereich der Versorgung mit Elektrizität",
den die Bundesnetzagentur gemäß §
51 Abs. 3 und § 63 Abs. 2
des Energiewirtschaftsgesetzes alle zwei Jahre vorlegen muss. Der Bericht untersucht
zwei Szenarien:
- Ein Zielszenario geht davon aus, dass die gesetzlichen und politischen Ziele
erreicht werden.
- Ein Szenario "Verzögerte Energiewende“ untersucht, wie sich z.B. ein verzögerter
Ausbau der Erneuerbaren und geringere Nachfrageflexibilitäten auf die Versorgungssicherheit
auswirken.
Die Stromversorgung in Deutschland ist demnach gewährleistet, wenn bis 2035
zusätzliche steuerbare Kapazitäten von bis zu 22,4 GW (Zielszenario) bzw. bis
zu 35,5 GW (Szenario "Verzögerte Energiewende") errichtet werden. Dies sind
Bruttowerte, die den Zubau ohne Stilllegungen beziffern. Der Vergleich der beiden
Szenarien zeigt, dass insbesondere eine ausbleibende bzw. verzögerte Flexibilisierung
des Stromverbrauchs den Bedarf an zusätzlichen steuerbaren Kapazitäten wie Kraftwerken
weiter erhöhen kann. Auch könnten Verzögerungen beim Zubau von Erzeugungsanlagen,
insbesondere auch der erneuerbaren Erzeugung dazu führen, dass der Strommarkt
die Nachfrage nicht vollständig decken kann. Für solche Situationen müssten
zusätzliche Reserven außerhalb des Strommarktes für die Versorgungssicherheit
eingesetzt werden. Da die Investitionen in steuerbare Kapazitäten bis heute
nicht ausreichen, ist es wichtig, den Ausbau zu unterstützen. Die Bundesnetzagentur
befürwortet deshalb den von der Bundesregierung geplanten gesetzlichen Rahmen
für zusätzliche Kraftwerke, die bis 2030 errichtet werden sollen.
Links (intern)
- Versorgungsqualität bei Strom weiterhin hoch (241109)
- Unternehmen klagen über Zunahme kurzfristiger Stromausfälle (240507)
- Versorgungssicherheit bei Strom weiterhin sehr hoch (231107)
- Amt für Katastrophenschutz bedauert mißverständliche Aussage zum Stromausfall-Risiko
(221112)
- Versorgungssicherheit noch größer als im Vorjahr (210810)
- Versorgungssicherheit war 2019 so hoch wie noch nie (201014)
- Link-Liste zu Störungen der Stromversorgung
bzw. zur Versorgungssicherheit
Link (extern, ohne Gewähr)
- PDF
Bericht zu Stand und Entwicklung der Versorgungssicherheit im Bereich der
Versorgung mit Elektrizität, Stand: September 2025 (79 S.)