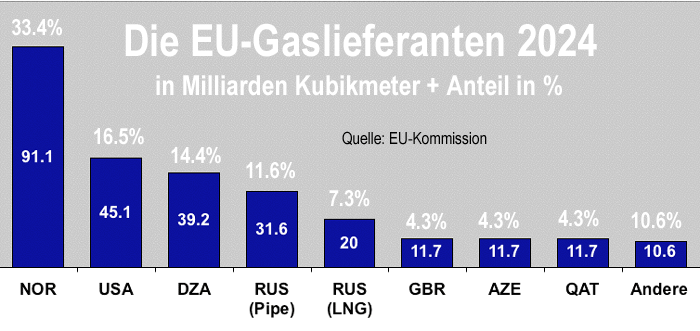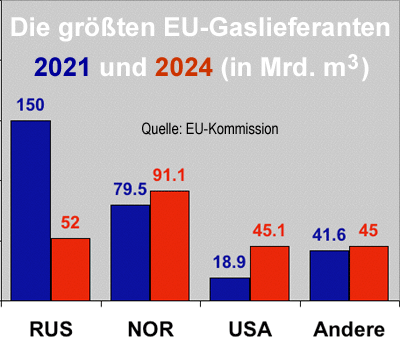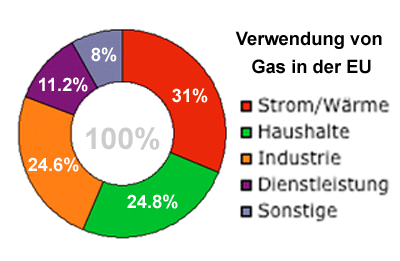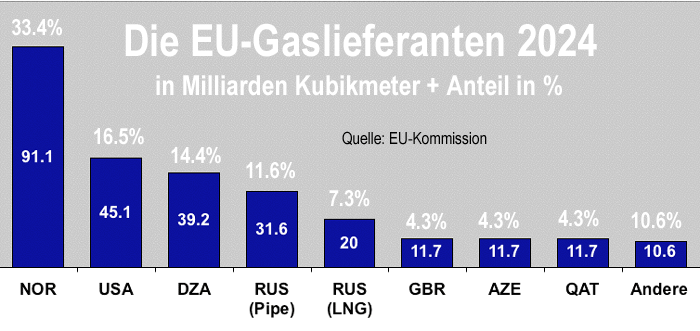 |
Norwegen ist infolge des russischen Eroberungskriegs gegen die
Ukraine zum wichtigsten Erdgas-Lieferanten der EU geworden. Im vergangenen
Jahr rangierte Russland aber mit einem Anteil von insgesamt fast19 Prozent
noch immer an zweiter Stelle, gefolgt von USA, Algerien, Großbritannien,
Aserbaidschan und Katar. In dieser Grafik wird bei den russischen EU-Importen
zwischen Pipeline- und LNG-Lieferungen unterschieden. Deshalb sieht
die Reihenfolge der Länder-Balken etwas anders aus. Wenn die jetzt vereinbarte
REPowerEU-Verordnung 2026 in Kraft tritt und tatsächlich im erhofften
Maße wirksam wird, gibt es ab 2028 überhaupt keine EU-Gasimporte aus
Russland mehr. Für den Kreml würde das den Verlust vieler Milliarden
bedeuten, mit denen er bisher seinen mörderischen Krieg in der Ukraine
finanzieren kann.
|
EU-Staaten beschlossen Importverbot für russisches LNG ab 2027
Die EU-Staaten beschlossen am 23. Oktober ein 19. Sanktionspaket gegen Russland.
Die neuen Maßnahmen konzentrieren sich auf Schlüsselbereiche wie Energie, Finanzen,
militärisch-industrielle Basis oder Sonderwirtschaftszonen. Vor allem wird die
Einfuhr von russischem Flüssiggas (LNG) ab 2027 verboten. Die bisherigen
Ausnahmen für die Öl- und Gaseinfuhren der russischen Energiekonzerne
Rosneft und Gazprom Neft werden aufgehoben. Das gilt aber nicht für Lukoil.
Auf Drängen von Slowakei, Ungarn und Bulgarien darf dieser russische Ölkonzern
sie weiter beliefern.
Die "Schattenflotte" umfasst jetzt 577 Schiffe
Die Liste der russischen "Schattenflotte" wird um 117 Tanker erweitert.
Dabei handelt es sich um meist ältere und mitunter schrottreife Öl- und Gastanker,
die Russland auf dem Weltmarkt akquiriert hat, um sie unter fremden Flaggen
und Vortäuschung falscher Eigentümer für den Export von Öl und Flüssiggas einzusetzen.
Die nun insgesamt 557 Schiffe auf dieser Liste dürfen in der EU keine Häfen
anlaufen oder Dienstleistungen empfangen. Weitere Sanktionen richten sich gegen
Unternehmen und Staaten, die beim Betrieb der Schattenflotte behilflich sind.
Slowakei erpresste ein weiteres Mal spezielle Zusicherungen
Wie schon beim 18. Sanktionspaket (250708) nutzte
die Slowakei die erforderliche Einstimmigkeit bei der Beschlussfassung wieder
aus, indem sie erst zustimmte, nachdem ihr spezielle Zusagen gemacht wurden.
Neben einer Absicherung gegen höhere Energiepreise verlangte der slowakische
Ministerpräsident Robert Fico eine Anpassung der Klimaziele an die Bedürfnisse
von Autoherstellern und Schwerindustrie seines Landes.
USA verbieten Geschäfte mit Rosneft und Lukoil, weil Trump sich von Putin
düpiert fühlt
Am selben Tag verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen die beiden
russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil. Betroffenen Unternehmen wurde eine
Frist bis zum 21. November eingeräumt, um ihre Geschäfte mit den beiden Ölproduzenten
zu beenden. Begründet wurde diese überraschende Unterstützung des europäischen
Sanktionspakets mit der Weigerung des russischen Präsidenten Putin, den Krieg
gegen die Ukraine zu beenden. Zuvor hatte US-Präsident Trump ein zunächst geplantes
Treffen mit Putin in Budapest abgesagt, weil davon sowieso nicht viel zu erwarten
sei. Demnach scheint Trump allmählich doch zu dämmern, dass ihn Putin, um dessen
Gunst er so beharrlich geworben hat, doch nur wie einen geistig beschränkten
Egomanen behandelt. Wie lange ein Sanktionsbeschluss Bestand hat, der auf gekränkter
Eitelkeit basiert, wird man abwarten müssen.
Zusätzliche Wirkung könnten die US-Sanktionen vor allem dadurch entfalten,
dass auch Indien unter US-amerikanischem Druck seine Öleinfuhren aus Russland
senkt. Neben China ist es der Hauptabnehmer von russischem Öl. Trump warf ihm
deshalb vor, Russlands Kriegskasse zu füllen. Als Strafmaßnahme verdoppelte
er den US-Zoll für Produkte aus Indien von 25 auf 50 Prozent. Am 21. Oktober
ließ er nach einem Gespräch mit dem indischen Regierungschef Modi wissen, dass
dieser eine Senkung der Importe zugesagt habe. Ob und wieweit das tatsächlich
zutrifft, wird sich – wie bei allem, was Trump so von sich gibt – erst noch
herausstellen müssen.
Energieminister einigten sich auf Vorschlag für "REPowerEU"-Verordnung
Am 20. Oktober verständigten sich die EU-Energieminister
in Luxemburg auf den Vorschlag für eine Verordnung, die ein rechtsverbindliches,
schrittweises Verbot der Einfuhren sowohl von Pipeline-Gas als auch von Flüssigerdgas
(LNG) aus Russland einführt. Im Unterschied zu dem drei Tage später vom Rat
beschlossenen 19. Sanktionspaket soll dieses vollständige Verbot auch für LNG
erst ab dem 1. Januar 2028 gelten. Laut Pressemitteilung des Rats wird damit
"ein ehrgeiziges Signal gesendet, den Ausstieg zu verwirklichen".
Die geplante Verordnung werde ein zentrales Element des "REPowerEU"-Fahrplans
zur Beendigung der Abhängigkeit von russischer Energie sein, den die EU-Kommission
im Mai dieses Jahres beschloss. Bereits im März 2022 hatte sie einen ersten
Entwurf vorgelegt, der vorsah, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern
aus Russland bis 2027 zu beenden (220303).
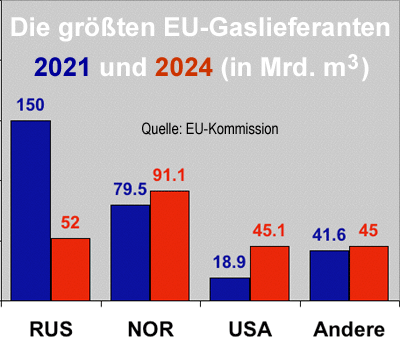 |
Wenn das Einfuhrverbot für russisches Gas ab dem 1. Januar 2026 in
Kraft tritt , gilt für bestehende Verträge ein Übergangszeitraum.
Insbesondere können kurzfristige Verträge, die vor dem 17. Juni 2025 geschlossen
wurden, bis zum 17. Juni 2026 fortgesetzt werden. Langfristige Verträge
können bis zum 1. Januar 2028 weiterlaufen. Änderungen an bestehenden Verträgen
sind nur für eng definierte operative Zwecke zulässig und dürfen nicht zu einer
Steigerung der Mengen führen. Davon ausgenommen sind einige spezifische Flexibilitätsregelungen
für Binnenmitgliedstaaten, die von den jüngsten Änderungen der Versorgungsrouten
betroffen sind.
Im Vergleich zum Vorschlag der Kommission hat der Rat die Zollverpflichtungen
für Einfuhren von nichtrussischem Gas erleichtert. In solchen Fällen muss den
Genehmigungsbehörden vor der Einfuhr von Gas in das Zollgebiet der EU nur der
Nachweis des Landes der Erzeugung vorgelegt werden. Während der Übergangsphase
müssen nähere Informationen zu Gaseinfuhren aus Russland vorgelegt werden (einschließlich
des Datums und der Laufzeit des Liefervertrags, der vertraglich vereinbarten
Mengen und etwaiger Vertragsänderungen).
Um sicherzustellen, dass das Verbot in der Praxis funktioniert, müssen für
russisches Gas und für Einfuhren, die in den Übergangszeitraum fallen, die für
die vorherige Genehmigung erforderlichen Informationen mindestens einen Monat
vor der Einfuhr vorgelegt werden. Für nichtrussisches Gas muss der Nachweis
mindestens fünf Tage vor der Einfuhr erbracht werden. Im Falle gemischter LNG-Ladungen
müssen die Unterlagen den jeweiligen Anteil von russischem und nichtrussischem
Gas an der Mischung belegen, wobei nur die nichtrussischen Mengen in die EU
eingeführt werden dürfen.
Eine spezielle Liste mit unproblematischen Ländern befreit deren Gasimporte
von der vorherigen Genehmigung
Um den Verwaltungsaufwand zu verringern, sind die Mitgliedstaaten übereingekommen,
dass dieses Verfahren zur vorherigen Genehmigung nicht für Einfuhren aus Ländern
gilt, die eine Liste von Kriterien der vorgeschlagenen Verordnung erfüllen.
Dadurch wird sichergestellt, dass nur die Einfuhren, die für die Kontrolle am
relevantesten sind, einer vorherigen Genehmigung unterliegen. Gemäß dem vereinbarten
Text beauftragt der Rat die Kommission, die Liste der ausgenommenen Länder innerhalb
von fünf Tagen nach Inkrafttreten der Verordnung zu erstellen. Darüber hinaus
wurden zusätzliche Überwachungs- und Meldemechanismen eingeführt, um zu verhindern,
dass russisches Gas im Rahmen von Versandverfahren in die EU gelangt (d. h.
solches Gas, das die EU auf dem Weg zu einem anderen Bestimmungsort durchquert,
ohne auf den EU-Markt zu gelangen).
Gemäß der vorgeschlagenen Verordnung müssen alle Mitgliedstaaten nationale
Diversifizierungspläne vorlegen, in denen Maßnahmen und potenzielle Herausforderungen
für die Diversifizierung ihrer Gasversorgung dargelegt werden. Der Rat hat zugestimmt,
Mitgliedstaaten, die nachweisen können, dass sie keine direkten oder indirekten
Einfuhren von russischem Gas mehr erhalten, von dieser Anforderung auszunehmen.
Die Anforderung zur Vorlage eines nationalen Diversifizierungsplans gilt für
die Mitgliedstaaten, die noch russisches Öl einführen, damit diese Einfuhren
bis zum 1. Januar 2028 eingestellt werden können.
Der Ratsvorsitz wird Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament aufnehmen,
sobald dieses seinen Standpunkt festgelegt hat, um eine Einigung über den endgültigen
Wortlaut der Verordnung zu erzielen.
Links (intern)
- Slowakei stimmte dem 18. Sanktionspaket gegen Russland doch noch zu (250708)
- Slowakei blockiert das 18. Sanktionspaket (250606)
- "Alarmstufe Gas" nach drei Jahren auf "Frühwarnstufe"
zurückgesetzt (250703)
- EU will Energie-Abhängigkeit von Russland vollständig beenden (250504)
- Was hat Putin mit Nord Stream 2 noch vor? (250508)
- Österreich kündigt Vertrag mit Gazprom (241205)
- Neues EU-Sanktionspaket soll russische LNG-Exporte erschweren (240603)
- Uniper kann von Gazprom 13 Milliarden Euro Schadenersatz verlangen (240604)
- EU füllt Putins Kriegskasse mit Gas-Importen aus Russland (240304)
- Sanktionen verhindern russische Öl- und Gasexporte nach Europa nicht (230914)
- EU will Umgehung der Sanktionen gegen Russland künftig besser verhindern
können (230606)
- EU will Abhängigkeit von russischem Gas erst bis 2027 beenden (220303)
- Link-Liste
zu Gasvorkommen, Gasförderung, LNG, Import/Export
- Link-Liste zu Ölpreisen, Ölförderung, Ölimport,
Spritpreisen
- Link-Liste
zur Ukraine (mit Sanktionen gegen Russland)