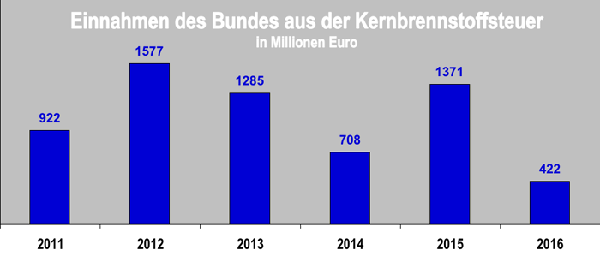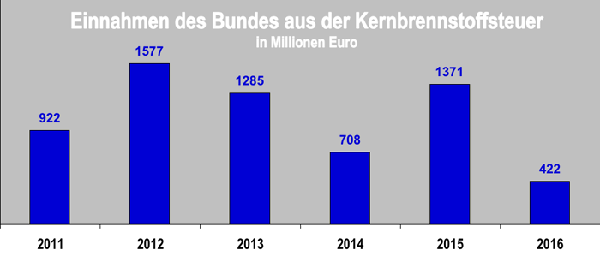 |
| Die insgesamt 6,285 Milliarden Euro, die der Bund während
der sechsjährigen Geltungsdauer des Kernbrennstoffsteuergesetzes
kassierte, muß er nun mit Zinsen den KKW-Betreibern
zurückzahlen. Die ohnehin unzureichenden Einzahlungen der
Atomkonzerne in den Entsorgungsfonds verringern sich dadurch
faktisch von 23,5 auf 16,5 Milliarden Euro. |
Rote Karte für Schwarz-Gelb
Die Kernbrennstoffsteuer hat vor dem
Bundesverfassungsgericht ebenfalls keinen Bestand
(zu 170601)
Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat jetzt die
Kernbrennstoffsteuer für verfassungswidrig erklärt. Allerdings mit
unterschiedlicher Begründung: Fünf der sieben Richter sehen den Sündenfall
darin, daß die Bundesregierung willkürlich eine neue Steuer erfunden habe,
die sich keiner der im Grundgesetz erwähnten Steuerarten zuordnen lasse.
Zwei Richter halten das Gesetz deshalb für verfassungswidrig, weil es
nicht mit der notwendigen Zustimmung des Bundesrats zustande gekommen ist.
Auch die Re-Revision des Atomgesetzes verstieß teilweise
gegen die Verfassung
Die schwarz-gelbe Koalition, die von 2009 bis 2013 regierte, bekommt
damit zum zweiten Mal nachträglich bescheinigt, daß sie mit
energiepolitischen Entscheidungen gegen die Verfassung verstieß. Erst vor
einem halben Jahr hatten die Karlsruher Richter die Re-Revision des
Atomgesetzes vom Sommer 2011 beanstandet und den Gesetzgeber bis 30. Juni
2018 zu Änderungen verpflichtet (161201). Sie
monierten jene überflüssigen Zutaten, die dem Gesetz letztendlich nur
deshalb eingefügt wurden, um den Eindruck einer reumütigen Rückkehr zur
rot-grünen Ausstiegsregelung zu vermeiden (siehe Hintergrund
Dezember 2016).
Verwaltungsgerichte erklärten Merkels "Moratorium" für
rechtswidrig
Noch unvergessen ist auch die höchstrichterliche Ohrfeige für das
"Moratorium", mit dem Angela Merkel nach der Katastrophe von Fukushima die
Abschaltung der sieben ältesten Kernkraftwerke durchsetzte (150201).
Es gab für diesen Theaterdonner weder eine juristische Handhabe noch einen
vernünftigen Grund. Er diente einzig der politischen Dramaturgie, mit der
die schwarz-gelbe Koalition ihre Wandlung vom Atom-Saulus zum
Energiewende-Paulus in Szene setzte. Verwaltungsrichter sind aber keine
Theaterkritiker, sondern haben das Handeln der Exekutive nach
rechtsstaatlichen Kriterien zu beurteilen (siehe Hintergrund
Februar 2015).
Neue Steuern dürfen nicht einfach erfunden werden...
Nun erweist sich also auch das Kernbrennstoffsteuergesetz als ein
brüchiges Konstrukt, dessen Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz gleich in
zweierlei Hinsicht fragwürdig ist. Die von der Mehrheit des Zweiten Senats
vertretene Ansicht, der "einfache Gesetzgeber" sei gar nicht zur Erfindung
einer solchen Steuer berechtigt gewesen, weil das Grundgesetz die
zulässigen Steuer-Kategorien erschöpfend aufzähle, dürfte dabei das
schwächere Argument sein. Tatsächlich läßt sich weder aus dem Buchstaben
noch aus dem Geist des Grundgesetzes eine solche Beschränkung eindeutig
herauslesen. Die in diesem Punkt bestehende Unklarheit wurde erst mit der
jetzigen Auslegung durch das Bundesverfassungsgericht beseitigt, das sich
damit wieder mal "rechtsschöpferisch" betätigt hat.
...und schon gar nicht ohne Zustimmung der Länder
Gewichtiger wirkt das Minderheitsvotum der beiden Richter Peter M. Huber
und Peter Müller, die das Gesetz deshalb für verfassungswidrig halten,
weil es ohne die Zustimmung des Bundesrats zustande kam. Tatsächlich darf
der Bund nicht einfach eine neue Steuer erfinden und beschließen, ohne
zuvor mit den Bundesländern abzuklären, ob und wieweit ihm die Erträge aus
dieser Steuer tatsächlich zustehen. Das bedeutet, daß die Ländervertretung
in jedem Falle zustimmen muß. Diese Zustimmung lag aber nicht vor, weil
das Kernbrennstoffsteuergesetz dem Bundesrat lediglich als sogenanntes
Einspruchsgesetz zugeleitet wurde.
Deklarierung als "Verbrauchssteuer" konnte nicht
funktionieren
Mit juristischer Bauernschläue hatten die Gesetzesmacher diese Klippe zu
umschiffen versucht, indem sie die Kernbrennstoffsteuer ausdrücklich als
"Verbrauchssteuer" deklarierten. Nach Artikel 106 des Grundgesetzes stehen
nämlich deren Erträge grundsätzlich dem Bund zu. Eine Verbrauchssteuer
würde allerdings voraussetzen, daß die Steuer am Ende tatsächlich vom
Verbraucher getragen wird. Das war hier von Anfang an umstritten. Die
Bundesregierung argumentierte selber damit, daß die Steuer nur die
zusätzlichen Gewinne mindere, die sich für die vier Konzerne aus der
Verlängerung der KKW-Laufzeiten ergeben würden. Es werde den
KKW-Betreibern gar nicht möglich sein, ihren Atomstrom zu anderen als
marktüblichen Preisen abzusetzen. Es hätte sich also um eine verkappte
Ertragssteuer gehandelt. Eine solche bedarf aber sowieso der Zustimmung
der Länder. In jedem Fall überschritt der Bund seine verfassungsmäßigen
Kompetenzen, wenn er ohne Zustimmung der Länder eine neue Steuer erfand,
die in kein herkömmliches Schema paßte, und deren Erträge er von
vornherein für sich beanspruchte.
Das Karlsruher Urteil war von Anfang an vorhersehbar
Es wirkt nicht sehr überzeugend, wenn der Kanzleramtsminister Peter
Altmaier nun sehr überrascht tut und gegenüber dem "Deutschlandfunk"
behauptet, dieses Urteil sei "völlig unvorhersehbar" gewesen. Als
Volljurist hätte er von Anfang an erkennen können, daß das ganze
Gesetzgebungspaket verfassungswidrig war, mit dem die schwarz-gelbe
Bundestagsmehrheit am 28. Oktober 2010 die Laufzeiten der deutschen
Atomkraftwerke verlängerte. Altmaier war damals Parlamentarischer
Geschäftsführer der Unionsfraktion. Es kann ihm deshalb auch nicht
entgangen sein, daß ein anderer Jurist – nämlich der
Linken-Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi – in der Bundestagsdebatte genau
den Knackpunkt ansprach, der in der Mißachtung der verfassungsmäßigen
Rechte der Länder bestand:
"Sie planen ganz bewußt einen Verfassungsbruch ein, indem Sie den
Bundesrat nicht beteiligen wollen. Sie planen den Verfassungsbruch nur
deshalb ein, weil Sie wissen, dass Sie im Bundesrat keine Mehrheit
haben. Das kann ein Bundesverfassungsgericht Ihnen nicht durchgehen
lassen. Dann wird Ihre ganze Gesetzgebung wieder platzen."
Gysi täuschte sich nur insofern, als nicht die ganze Gesetzgebung
platzte, sondern – als Spätzünder mit sieben Jahren Verzögerung –
lediglich die Kernbrennstoffsteuer. Das lag daran, daß knapp ein halbes
Jahr nach dieser Bundestagsdebatte etwas anderes platzte, nämlich die
Reaktoren im japanischen Kernkraftwerk Fukushima. Die schwarz-gelbe
Regierung von Angela Merkel vollzog daraufhin ihre bekannte atompolitische
Kehrtwende. Die eben erst beschlossene Laufzeiten-Verlängerung für die 17
deutschen Reaktoren landete deshalb erst gar nicht vor dem
Bundesverfassungsgericht, sondern wurde von ihren Urhebern selber wieder
eingestampft.
Nach ihrer atompolitischen Wende wagte die Koalition
nicht, die Steuer rückgängig zu machen
Was jedoch in Kraft blieb, war die Kernbrennstoffsteuer. Faktisch war sie
in enger Verbindung mit der Laufzeiten-Verlängerung eingeführt worden.
Formal war sie aber mit der Laufzeiten-Verlängerung nicht verknüpft. Das
unterschied sie von den "Förderbeitragen" für den neuen Energie- und
Klimafonds, die den Atomkonzernen auf Grundlage eines mit dem
Bundesfinanzministeriums geschlossenen Vertrags abverlangt wurden und die
sie ausdrücklich mit allen Kosten verrechnen durften, die sich aus nicht
abgesprochenen Belastungen der Kernenergie ergeben würden.
Als der Koalitionsausschuß von Union und FDP am 29. Mai 2011 über die
atompolitische Kehrtwendung nach Fukushima beriet, hielt er es deshalb
nicht für opportun, diese Steuer wieder abzuschaffen. Die Höhe der Erträge
– die jetzt ohnehin geringer ausfallen würden – stand dabei sicher nicht
im Vordergrund. Vielmehr ging es darum, der Opposition keine
Angriffsflächen zu bieten. Als Bestandteil des Gesamtpakets zur
Verlängerung der Laufzeiten für alle deutschen Atomkraftwerke war die
Kernbrennstoffsteuer zwar nur mit den Stimmen der schwarz-gelben Koalition
beschlossen worden (101002). Grundsätzlich
hielten es aber alle Bundestagsparteien für eine löbliche Absicht,
wenigstens einen Teil der Extra-Profite, welche die KKW-Betreiber nun
einheimsen würden, über die Besteuerung der Brennelemente zurückzuholen (100704).
Die Koalition wollte sich keinesfalls dem Vorwurf aussetzen, mit der
Rücknahme der Kernbrennstoffsteuer schon wieder die Atomkonzerne zu
begünstigen.
In dem Ende Mai 2011 verabschiedeten Koalitionspapier wurde die
Kernbrennsstoffsteuer deshalb vorsichtshalber erst gar nicht
problematisiert, sondern ihre Beibehaltung quasi beiläufig angekündigt,
indem man ihre Erträge einem löblichen Zweck widmete: "Die Einnahmen aus
der Brennelementesteuer dienen u.a. dem Zweck, die aus der notwendigen
Sanierung der Schachtanlage Asse II entstehenden Haushaltsbelastungen zu
reduzieren." (110501)
Die juristische Niederlage war vorhersehbar und wurde
bewußt in Kauf genommen
Den Verantwortlichen muß dabei bewußt gewesen sein, daß die KKW-Betreiber
die Beibehaltung der Brennelemente-Steuer nicht hinnehmen und die
Erfolgsaussichten ihrer Klagen sehr gut sein würden. Sie sind somit
sehenden Auges das Risiko einer Rückzahlung der vereinnahmten Milliarden
eingegangen, zuzüglich enormer Zinsen, von denen ein Sparer nur träumen
kann.
Das ist keine bloße Vermutung, sondern ergibt sich aus dem schriftlich
dokumentierten Kuhhandel, welcher der Laufzeiten-Verlängerung vorausging:
In einer zunächst geheimen Vereinbarung vom 6. September 2010 hatten
Bundesregierung und Atomkonzerne detailliert den Inhalt jenes
Gesetzespakets zur Laufzeiten-Verlängerung festgelegt, das dann am 28.
Oktober 2010 von der schwarz-gelben Mehrheit des Bundestags abgenickt
wurde (100901). Jedem der 17 Reaktoren wurde
darin eine exakt bemessene Erhöhung der Reststrommenge in Terawattstunden
zugeteilt. Im Gegenzug verpflichteten sich die KKW-Betreiber zu genau
festgelegten Förderbeiträgen für den Energie- und Klimafonds (siehe PDF).
Die Kernbrennstoffsteuer tauchte ebenfalls schon in diesem Papier auf,
war aber nur indirekt Bestandteil der Vereinbarungen. Die Bundesregierung
kündigte an, diese neue Abgabe "unabhängig von diesem Vertrag"
einführen zu wollen. Die KKW-Betreiber erreichten aber zwei wichtige
Zugeständnisse, die sich in den Paragraphen 3
und 12 des späteren
Kernbrennstoffsteuergesetzes niederschlugen: Zum einen war das die
Begrenzung der Steuer auf 145 Euro pro Gramm Brennstoff, zum anderen die
Befristung des Gesetzes bis Ende 2016. Andernfalls wären die KKW-Betreiber
berechtigt gewesen, ihre "Förderbeiträge" zum Energie- und Klimafonds um
die zusätzlich entstehenden Kosten zu kürzen.
Außerdem akzeptierte die Bundesregierung, daß die KKW-Betreiber eventuell
vor Gericht ziehen würden: Ihr sei bekannt – so hieß es in diesem Papier –
"daß EVUs und KKW-Betreibergesellschaften erhebliche Zweifel an
rechtlicher Zulässigkeit der Erhebung einer Kernbrennstoffsteuer haben
und daß sie sich nach ihrer Meinung, schon aus aktienrechtlichen
Gründen, unabhängig von diesem Vertrag rechtliche Schritte gegen
dieses Gesetz und die Erhebung der Steuer vorbehalten müssen".
Zusätzlich bekam die Bundesregierung von den Atomkonzernen eine
ausführliche rechtliche Bewertung, in der unter anderem festgestellt
wurde, daß die "Brennelementesteuer nicht unter verfassungsrechtlich
verbürgte Steuerarten (Art. 106 GG) subsumierbar" sei und "Brennelemente
nach BVerfG-Rechtsprechung kein tauglicher Gegenstand einer
Verbrauchssteuer I.S.d. Art. 108 Abs. 1 Nr. 2 GG" seien.
Prozeßrisiko war als Fallgrube für künftige
Bundesregierungen gedacht
Die Bundesregierung wußte also von dem Prozeßrisiko. Wenn sie es trotzdem
hinnahm, lag das nicht an mangelnder Stichhaltigkeit der juristischen
Bedenken, sondern an der Unwahrscheinlichkeit, daß die KKW-Betreiber
tatsächlich prozessieren würden. Die Einstufung als "Verbrauchssteuer" war
von Anfang an eine juristisch unhaltbare Fiktion. Es könnte sich deshalb
sogar der Verdacht aufdrängen, daß beide Seiten den Konflikt in diesem
Punkt absichtlich inszeniert haben, um spätere Regierungen erpreßbar zu
machen, falls diese weniger Wohlwollen gegenüber der Atomlobby zeigen
sollten.
Jedenfalls handelte es sich vorläufig nur um eine Drohgebärde: Die
KKW-Betreiber wären schlecht beraten gewesen, eine Bundesregierung zu
verklagen, die ihnen zu einer milliardenschweren Laufzeiten-Verlängerung
verhalf und nur geringe Abstriche an den zusätzlichen Profiten verlangte.
Ihre Drohung mit einer eventuellen Klage galt letztendlich auch gar nicht
der schwarz-gelben Koalition. Sie zielte in erster Linie auf spätere
Regierungen, falls diese es wagen sollten, die getroffenen Vereinbarungen
wieder in Frage zu stellen. Schließlich standen schon im Herbst 2013
wieder Bundestagswahlen an.
Mit der Rücknahme der Laufzeiten-Verlängerung entfiel die
bisherige Geschäftsgrundlage
Wegen der atompolitischen Wende der schwarz-gelben Koalition änderte sich
dann die Geschäftsgrundlage viel schneller, radikaler und auf andere
Weise, als vorhersehbar gewesen war. Die Atomkonzerne fühlten sich nun von
ihren treuesten politischen Verbündeten plötzlich im Stich gelassen. –
Grund genug für sie, nun ihrerseits keine Rücksicht mehr zu nehmen,
sondern alle Register zu ziehen, um die längst bekannten und sogar
vorsätzlich eingebauten Schwachstellen des Gesetzespakets für
Schadenersatzklagen zu nutzen.
Als erster Konzern gab RWE seine Zurückhaltung auf und klagte durch alle
Instanzen der Verwaltungsgerichtsbarkeit erfolgreich gegen das
"Moratorium" (140110, 151214).
Es folgten die Klagen gegen die Re-Revision des Atomgesetzes, denen das
Bundesverfassungsgericht Ende 2016 zumindest teilweise stattgab (161210).
Im Sommer 2011 klagten RWE und E.ON (110607)
sowie die EnBW (110704) dann auch gegen die
Brennelementesteuer. Im April 2014 verpflichtete das Finanzgericht Hamburg
die Hauptzollämter zur Rückzahlung von insgesamt 2,2 Milliarden Euro an
E.ON und RWE, weil das Kernbrennstoffgesetz keine Verbrauchssteuer und
verfassungswidrig sei (140405). Es kam aber noch
nicht zur Rückzahlung, da die höchstinstanzliche Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts noch ausstand und der Bundesfinanzhof die
vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils aufhob (141213)
.
Zwischendurch, im Juni 2015, stellte bereits der Europäische Gerichtshof
fest, daß die Kernbrennstoffsteuer keine Verbrauchsteuer sei. Für die
Vereinbarkeit mit dem EU-Recht spielte das allerdings keine Rolle.
Entscheidend war die Feststellung, daß es sich um keine staatliche
Beihilfe handele. Die Luxemburger Richter konnten das Gesetz deshalb nicht
beanstanden (150603). Ganz andere Bedeutung hatte
derselbe Befund indessen für die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz,
weshalb das Gesetz jetzt vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt
wurde.
Faktisch zahlen die
Atomkonzerne jetzt nur noch 16,5 Milliarden Euro in den Entsorgungsfonds
Die Verantwortung für die erfolgreichen Schadenersatzklagen der
KKW-Betreiber trägt nicht nur Angela Merkels schwarz-gelbe
Bundesregierung. Ihr folgendes Kabinett der Großen Koalition, das bis
heute regiert, ist ebenfalls schuld daran, wenn dem Steuerzahler nun
schätzungsweise sieben Milliarden Euro abverlangt werden. Es wäre der
Großen Koalition durchaus möglich gewesen, bei den Verhandlungen über das
"Gesetz zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen
Entsorgung" (161005) den Atomkonzernen entweder
den Verzicht auf alle Entschädigungsansprüche oder eine entsprechend
höhere Einzahlung in den Entsorgungsfonds abzuverlangen. Dies wurde aber
mit voller Absicht unterlassen. Die schwarz-rote Koalition begnügte sich
mit der eher symbolischen Rücknahme von zwanzig Klagen, die nach damaligen
Angaben insgesamt etwa ein Zehntel aller Entschädigungsansprüche
ausmachten (161204), tatsächlich aber noch
bedeutungsloser waren (170602).
So wurden die Atomkonzerne für nur 23,5 Milliarden Euro von ihren
Entsorgungsverpflichtungen befreit – eine Summe, die ohnehin niemals
ausreichen wird, um die künftig vom Staat zu tragenden
Entsorgungsverpflichtungen zu finanzieren. Als der Bundestag Ende 2016 die
Neuregelung der Atomhaftung beschloß (161202),
durften die KKW-Betreiber von dieser Summe schon mal die sieben Milliarden
Euro abziehen, die ihnen die Klagen gegen die Brennelemente-Steuer
einbringen würden.
Kanzleramt wies Kommission an, über die Rücknahme der
Klage nicht zu verhandeln
Genau genommen war der Rabatt, der die Einzahlungen der Atomkonzerne in
den Entsorgungsfonds faktisch um sieben Milliarden auf 16,5 Milliarden
Euro verringerte, von Anfang an eingeplant. Als die Bundesregierung im
Oktober 2015 die "Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des
Kernenergieausstiegs" einsetzte (151003),
die dann im April 2016 ihre Vorschläge vorlegte (160402),
geschah dies mit der ausdrücklichen Auflage, die vor dem
Bundesverfassungsgericht anhängige Klage gegen die Kernbrennstoffsteuer
nicht zum Verhandlungsgegenstand zu machen. Die diesbezügliche Anweisung
kam schon bei einer der ersten Sitzungen direkt aus dem Kanzleramt. Dies
bekundete jetzt der Kommissionsvorsitzende Jürgen Trittin gegenüber dem
Fernsehmagazin "Monitor" (15.6.).
Die schweren Fehler bei der Re-Revision des Atomgesetzes
kommen ebenfalls noch teuer zu stehen
Es kommt aber noch dicker: RWE, E.ON und Vattenfall können zusätzlich
jene Ansprüche in bares Geld verwandeln, die sich aus dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom Dezember 2016 ergeben, das die
schwarz-gelben Zutaten zum Atomausstieg für entschädigungspflichtig
erklärte (161201). Diese sind nämlich nicht
Bestandteil ihres öffentlich-rechtlichen Vertrags mit der Bundesregierung,
der am 26. Juni unterzeichnet wurde und in dem sie die nunmehr garantierte
Abwälzung der Entsorgungslasten auf den Staat mit der äußerst bescheidenen
Gegenleistung eines Verzicht auf zwanzig Klagen honorieren, die sowieso
größtenteils obsolet geworden sind (170602).
Konkrete Schadenersatzforderungen sind bisher nicht bekannt. Vermutlich
wollen die Konzerne erst mal die Gesetzesänderungen abwarten, die aufgrund
des Urteils bis 30. Juni 2018 erfolgen müssen.
Unabhängig davon hält der schwedische Vattenfall-Konzern die Klage
aufrecht, die er vor dem Schiedsgericht bei der Weltbank in Washington
(ICSID) erhoben hat (141001). Vattenfall verlangt
von der Bundesregierung 4,7 Milliarden Euro zuzüglich Zinsen an
Schadenersatz, weil durch die im Juni 2011 beschlossene Änderung des
Atomgesetzes die sofortige Stillegung seiner Kernkraftwerke Brunsbüttel
und Krümmel verfügt wurde (siehe 110601 und Hintergrund,
Oktober 2016).
Insgesamt bekommen so die Atomkonzerne voraussichtlich den größeren Teil
ihrer ohnehin unzureichenden Einzahlungen in den Entsorgungsfonds wieder
zurück. Die beiden Merkel-Regierungen stehen dann ähnlich da wie der "Hans
im Glück", der sich einen Klumpen Gold sukzessive gegen minderwertige
Güter abschwatzen ließ. Trotz einer unglaublichen Fülle an juristischer
Ignoranz und Fahrlässigkeit wird man ihnen aber – das unterscheidet sie
von der Märchenfigur – kaum die eigene Dämlichkeit zugute halten können.
Wie diese Darstellung zeigt, spielte vorsätzliches Handeln zum Nachteil
des Steuerzahlers und zur Begünstigung der Atomkonzerne eine ganz
wesentliche Rolle.