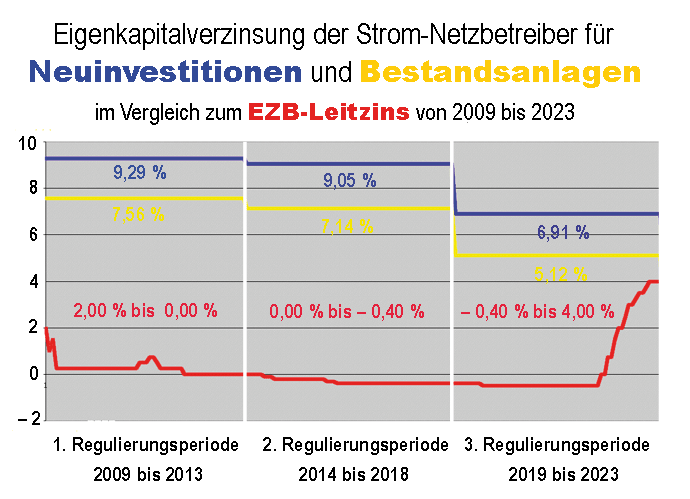|
Im Vergleich mit dem EZB-Leitzins, der von 2009 bis 2023 meistens bei
null Prozent und darunter lag, waren die Eigenkapitalrenditen der Stromnetzbetreiber
in den drei ersten Regulierungsperioden mehr als auskömmlich. Die Bundesnetzagentur
wollte sie deshalb in der ab 2024 beginnenden vierten Regulierungperiode
spürbar beschneiden, indem sie die Renditen für Neuinvestitionen auf
5,07 Prozent und für Bestandsanlagen auf 3,51 Prozent senkte. Dagegen
klagten rund 900 Strom- und Gasnetzbetreiber vor dem Oberlandesgericht
Düsseldorf. Zunächst waren sie damit erfolgreich, bis der Bundesgerichtshof
jetzt dieses Urteil aufhob.
Quellen: Bundesnetzagentur / Bundesbank
|
Stromnetzbetreiber scheitern mit Klagen auf höhere Eigenkapitalrenditen
Kurz vor Weihnachten hat der Bundesgerichtshof acht Musterentscheidungen des
Oberlandesgerichts Düsseldorf aufgehoben, mit denen die Bundesnetzagentur verpflichtet
wurde, den Stromnetzbetreibern für die gegenwärtige vierte Regulierungsperiode
eine höhere Eigenkapitalverzinsung zu gewähren, als sie in einer Festlegung
der Behörde vom 12. Oktober 2021 vorgesehen war. Geklagt hatten rund 900 Strom-
und Gasnetzbetreiber. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte diese Beschwerden
zu insgesamt vierzehn repräsentativen Musterverfahren gebündelt, die es am 30.
August 2023 zugunsten der Kläger entschied.
Über die Klagen der Gasnetzbetreiber wird am 25. Februar verhandelt
In einer mündlichen Verhandlung am 17. Dezember verwarf der Kartellsenat des
Bundesgerichtshofs zunächst nur die acht Musterentscheidungen, mit denen den
Stromnetzbetreibern eine höhere Eigenkapitalverzinsung zuerkannt wurde. Über
die sechs Musterverfahren der Gasnetzbetreiber soll in einer weiteren Verhandlung
am 25. Februar entschieden werden. Da es sich um sehr ähnliche Sachverhalte
handelt, ist hier ebenfalls eine Aufhebung der vorinstanzlichen Urteile zu erwarten.
Regulierungsbehörde hat Anspruch auf "Ermessensspielraum bei der Wahl
der richtigen Bemessungsmethode"
Bisher gibt es zu diesen Entscheidungen des Kartellsenats keine offizielle
Verlautbarung. Die entschiedenen Musterverfahren sind in der BGH-Datenbank auch
noch nicht abrufbar. Immerhin bestätigte aber der Bundesgerichtshof gegenüber
der Deutschen Presse Agentur (DPA) die Aufhebung der vorinstanzlichen Urteile,
worauf der seit 13 Monaten schwächelnde Kurs der E.ON-Aktie noch etwas tiefer
rutschte. Überrascht hat nicht nur die Aufhebung der Urteile, sondern auch die
voraussichtliche Begründung: Laut DPA signalisierte in der mündlichen Verhandlung
der Vorsitzende Richter Wolfgang Kirchhoff, dass der Bundesnetzagentur ein "Ermessensspielraum
bei der Wahl der richtigen Bemessungsmethode" zustehe, der nicht durch
ein Gericht untergraben werden dürfe.
Bundesnetzagentur bekam neue Kompetenzen, die ihr bisher vorenthalten wurden
Diese Bemerkung bezieht sich offenbar auf den neuen rechtlichen Stellenwert,
den die Bundesnetzagentur erlangt hat, nachdem der Bundestag im November 2023
ihren Kompetenzbereich erweiterte und ihre Unabhängigkeit stärkte (231109).
Die Reform kam auf Drängen der EU-Kommission (180705)
und letztendlich durch eine im September 2021 ergangene Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs zustande (210901).
Nach Feststellung der Luxemburger Richter wurden die 2009 in Kraft getretenen
neuen EU-Richtlinien für die Binnenmärkte bei Strom und Gas (090401)
durch die im Juni 2011 beschlossene Neufassung des Energiewirtschaftsgesetzes
(110602) von der damals regierenden schwarz-roten Koalition
in etlichen Punkten fehlerhaft in nationales Recht umgesetzt. Vor allem wurden
Befugnisse, die das Unionsrecht den Regulierungsbehörden übertrug, durch den
§ 24 des Energiewirtschaftsgesetzes
weiterhin auf den Verordnungsgeber verlagert.
Um die Verstöße gegen das EU-Recht rückgängig zu machen und die Kompetenzen
der Bundesnetzagentur entsprechend zu erweitern, werden die einschlägigen Verordnungen
nun bis Ende 2028 schrittweise außer Kraft gesetzt und durch Vorgaben der Bundesnetzagentur
ersetzt. Im Zusammenhang damit startete die Bundesnetzagentur Anfang 2024 ein
Konsultationsverfahren zur Weiterentwicklung der seit 2009 praktizierten "Anreizregulierung"
(250108).
Die Regulierungsperioden dauern jeweils fünf Jahre, sind aber für Strom- und
Gasnetze um ein Jahr versetzt
Nach § 3 der Anreizregulierungsverordnung
(ARegV) dauern die Regulierungsperioden jeweils fünf Jahre. Für Gasnetze wurde
jedoch die erste Regulierungsperiode durch §
34 Abs. 1a auf vier Jahre verkürzt. Beginn und Ende der Regulierungsperioden
für Strom- und Gasnetze verschieben sich deshalb jeweils um ein Jahr: Für die
Gasnetzbetreiber trat die vierte Regulierungsperiode bereits 2023 in Kraft und
dauert bis 2027. Für die Stromnetzbetreiber dauert sie von 2024 bis 2028. Nach
aktuellem Stand der Diskussion dürfte es anschließend zu einer Verkürzung der
Laufzeiten auf drei Jahre kommen (250108).
Die zulässige Eigenkapitalverzinsung begrenzt von vornherein die Höhe der
Rendite
Die Eigenkapitalverzinsung ist normalerweise eine fiktive rechnerische Größe,
die von Unternehmen nachträglich anhand des erzielten Jahresüberschusses ermittelt
wird, damit die Anteilseigner einschätzen können, wie sich ihre Kapitaleinlage
gegenüber einer marktüblichen Verzinsung rentiert hat. Im Rahmen der "Anreizregulierung"
dient sie jedoch einem anderen Zweck: Hier ist sie ein im voraus festgelegter
Zinssatz, der für die jeweils fünf Jahre dauernden Regulierungsperioden die
zulässige Rendite auf das Eigenkapital begrenzt. Diese Begrenzung ist notwendig,
da es sich beim Netzbetrieb um ein konkurrenzloses "natürliches Monopol"
handelt, dessen Gesamtkosten einschließlich der Renditen in die Netzentgelte
eingehen und letztendlich von den Energieverbrauchern bezahlt werden müssen.
Schon eine Erhöhung der zugestandenen Eigenkapitalrendite um ein Prozent bedeutet
für die Stromverbraucher Mehrkosten im Bereich von einer Milliarde Euro – oder
umgekehrt entsprechende Mehreinnahmen für die Netzbetreiber.
Für die ersten zwei Regulierungsperioden konnten sich die Netzbetreiber deutlich
höhere Renditen sichern als zunächst geplant war
Die von der Bundesnetzagentur vorgesehene Eigenkapitalverzinsung stieß deshalb
bisher immer auf hartnäckigen Widerspruch der Netzbetreiber, während die Energieverbraucher
gegenüber der organisierten Lobby einen eher schwachen Stand hatten (siehe Links).
Schon vor Beginn der ersten Regulierungsperiode endete dieser ungleiche Konflikt
damit, dass die Bundesnetzagentur den Netzbetreibern deutlich höhere Eigenkapitalverzinsungen
zugestand, als sie ursprünglich für angemessen gehalten hatte: Bei Neuinvestitionen
waren es 9,29 statt 7,82 Prozent, und bei Bestandsanlagen 7,56 statt 6,37 Prozent
(080710). Diese Nachgiebigkeit wiederholte sich dann
vor Beginn der zweiten Regulierungsperiode: Auch hier verzichtete die Behörde
schon im Konsultationsverfahren weitgehend auf die ursprünglich geplante Absenkung,
obwohl der EZB-Leitzins inzwischen auf null gefallen war (111007).
Als die Bundesnetzagentur standhaft blieb, klagten die Netzbetreiber zweimal
erfolgreich beim OLG Düsseldorf, unterlagen aber beim BGH in Karlsruhe
Bei der Festlegung der Eigenkapitalverzinsung für die dritte Regulierungsperiode
wollte die Bundesnetzagentur aber nicht mehr mit sich handeln lassen, nachdem
sie im Juli 2016 eine geplante Senkung der Sätze für Neuinvestitionen von 9,05
auf 6,91 Prozent und für Bestandsanlagen von 7,14 auf 5,12 Prozent angekündigt
hatte. "Die gesunkenen Zinssätze spiegeln das derzeit geringe Zinsniveau
an den Kapitalmärkten wider. Höhere Eigenkapitalrenditen im Netzbereich wären
den Stromverbrauchern nicht vermittelbar", erklärte der damalige Behördenchef
Jochen Homann (160709).
Die Branchenlobby sah das naturgemäß wieder anders und forderte mindestens
einen Prozentpunkt mehr (160806). Die Bundesnetzagentur
beließ es trotzdem bei der Festlegung (161004).
Daraufhin beschritten die Netzbetreiber erstmals den Klageweg. Sie hatten damit
zunächst auch Erfolg, indem das Oberlandesgericht Düsseldorf im März 2018 befand,
dass die Rendite zu niedrig angesetzt worden sei. Anscheinend hielten die Richter
den Betrieb und Ausbau von Stromnetzen für ein hochriskantes Geschäft, das durch
einen entsprechend hohen "Wagniszuschlag" gewürdigt werden müsse.
Der Bundesgerichtshof ließ sich von dieser Sichtweise allerdings nicht beeindrucken
und hob das Urteil im Juli 2019 wieder auf (190710).
Einen ähnlichen Erfolg erzielten die Netzbetreiber mit ihren Klagen gegen die
Festlegung zur bevorstehenden vierten Regulierungsperiode, die von der Bundesnetzagentur
am 12. Oktober 2021 veröffentlicht wurde. Auch hier befand das Oberlandesgericht
Düsseldorf am 30. August 2023, die Festlegung sei für Betreiber von Stromnetzen
"materiell rechtswidrig, weil die Bundesnetzagentur es versäumt hat, die
von ihr rechtsfehlerfrei anhand langfristiger historischer Datenreihen ermittelte
Marktrisikoprämie – jedenfalls durch eine ergänzende Plausibilisierung – weiter
abzusichern". Für Gasnetzbetreiber sei sie ebenfalls rechtswidrig, "weil
die Bundesnetzagentur die Höhe des Zuschlags zur Abdeckung netzbetriebsspezifischer
unternehmerischer Wagnisse im Sinne des § 7Abs.5 GasNEV rechtsfehlerhaft ermittelt
hat".
Der EZB-Leitzins lag zehn Jahre lang bei null Prozent und darunter
Zumindest psychologisch bekamen die Kläger dabei starken Rückenwind durch den
plötzlich wieder steigenden EZB-Leitzins. Dieser war im Juli 2012 auf null Prozent
gesunken und dann mit bis zu minus 0,50 Prozent zu einem reinen Strafzins geworden.
Nun erreichte er im Juli 2022 – also neun Monate, nachdem die Bundesnetzagentur
ihre Festlegung veröffentlicht hatte – wenigstens wieder die Null-Prozent-Grenze.
Als das Oberlandesgericht Düsseldorf dann den Klagen der Netzbetreiber stattgab
– das war weitere dreizehn Monate später –, lag er zum ersten Mal seit 23 Jahren
wieder bei 3,75 Prozent. Im darauffolgenden Monat erreichte er mit 4,0 Prozent
sogar einen bislang unerreichten Höhepunkt. Seit Juni 2024 sinkt er allerdings
schon wieder und ist aktuell bei 3,0 Prozent angelangt.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf vermied es indessen, die Ungültigkeit der
vor knapp zwei Jahren getroffenen Festlegung auch mit dem inzwischen deutlich
günstigeren Zinsumfeld zu begründen. Es stellte vielmehr fest, dass die Änderung
der EZB-Zinspolitik zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht absehbar gewesen
sei. Deshalb habe sie von der Bundesnetzagentur auch nicht berücksichtigt werden
können. Ob und in welcher Weise sie nun im Rahmen der aktuellen Urteilsfindung
dennoch zu berücksichtigen sei, könne jedoch offen bleiben da die Bundesnetzagentur
aus anderen Gründen ohnehin zur Revision ihrer Festlegung verpflichtet werde.
Dabei habe sie dann neben den beanstandeten Mängeln auch die inzwischen eingetretene
Veränderung des Zinsniveaus zu beachten.
So sah alles nach einem weiteren Erfolg der Netzbetreiber aus, bis der Bundesgerichtshof
am 17. Dezember zumindest den Stromnetzbetreibern erneut einen unerwarteten
Strich durch die Rechnung machte. Und wahrscheinlich wird es den Gasnetzbetreibern
am 25. Februar ähnlich ergehen.
Schon seit einem Jahr gilt für Neuinvestitionen eine verbesserte Eigenkapitalverzinsung
Trotzdem bedeutet die Aufhebung des Düsseldorfer Urteils durch den Bundesgerichtshof
nicht, dass es nun tatsächlich beim Beschluss der Bundesnetzagentur vom 12.
Oktober 2021 bleibt, die Neuinvestitionen von bisher 6,91 auf 5,07 Prozent und
für Bestandsanlagen von 5,12 auf 3,51 Prozent zu senken. Die Bundesnetzagentur
hat inzwischen nämlich selber festgestellt, dass ihr vor über drei Jahren getroffener
Beschluss infolge des Anstiegs des EZB-Leitzinses und anderer Faktoren ergänzungsbedürftig
geworden ist.
Schon vor einem Jahr veröffentlichte die Behörde dazu eine neue Festlegung,
die nach zwei Konsultationsrunden mit Netzbetreibern und Netzkunden zustande
kam. Um unvorhergesehene und aufgrund des aktuellen Umfelds notwendig gewordene
Netzinvestitionen zu fördern, legte sie eine neue Berechnungsweise für den Eigenkapitalzins
von Neuinvestitionen fest. Faktisch wird es dadurch für den Rest der Regulierungsperiode
kaum noch Abstriche gegenüber der früher geltenden Eigenkapitalverzinsung von
6,91 Prozent geben. Unter Umständen könnte die Rendite sogar etwas höher ausfallen.
Unverändert gültig bleiben soll nur die Absenkung der Eigenkapitalverzinsung
für Bestandsanlagen auf 3,51 Prozent.
Links (intern)
zur Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur
- Regulierungsbehörde bekommt mehr Kompetenzen (231109)
- Bundesnetzagentur muss unabhängiger werden (210901)
- Brüssel verlangt mehr Rechte für Bundesnetzagentur (180705)
zur Festlegung der Eigenkapitalrenditen für Netzbetreiber
- Bundesnetzagentur nimmt Abstriche an Abstrichen vor (211004)
- Netzbetreiber verlangen höhere Eigenkapitalverzinsung (210809)
- Bundesgerichtshof bestätigt Abstriche an Netzrenditen (200411)
- Netzbetreiber müssen Senkung ihrer Renditen akzeptieren (190710)
- Branchenverbände kritisieren neuen GSP für die Anreizregulierung bei Strom
(181210)
- Netzentgelte sind vermutlich oft überhöht, können aber nicht überprüft werden
(180805)
- Gericht hält Senkung der hohen Netz-Renditen für rechtswidrig (180306)
- Bundesnetzagentur senkt Eigenkapitalrenditen ohne Abstriche (161004)
- Netzbetreiber halten geplante Abstriche an der Eigenkapitalverzinsung für
zu hoch (160806)
- Neue Anreizregulierungsverordnung kann in Kraft treten (160805)
- Bundesnetzagentur will Eigenkapitalverzinsung um gut zwei Prozent kürzen
(160709)
- Bundesnetzagentur gibt Druck der Netzbetreiber nach und kürzt Renditen nur
geringfügig (111007)
- Bundesnetzagentur will Netzbetreibern die Rendite kürzen (110906)
- Netzbetreiber dürfen sich auf noch höhere Renditen freuen (100905)
- Bundesregierung will Netzbetreibern noch höhere Gewinne bescheren (100502)
- Bundesnetzagentur genehmigt erstmals Netzinvestitionen (090407)
- Netzbetreiber wollen noch höhere Eigenkapitalverzinsung erreichen (090309)
- Eigenkapitalverzinsung der Netzbetreiber wird erhöht statt gesenkt (080710)
- Bundesnetzagentur will Eigenkapitalverzinsung der Netzbetreiber kürzen (080510)
- Regulierungsbehörde sieht weiteren Spielraum für Senkung der Netzentgelte
(080108)
- Anreizregulierungsverordnung trat in Kraft (071103)