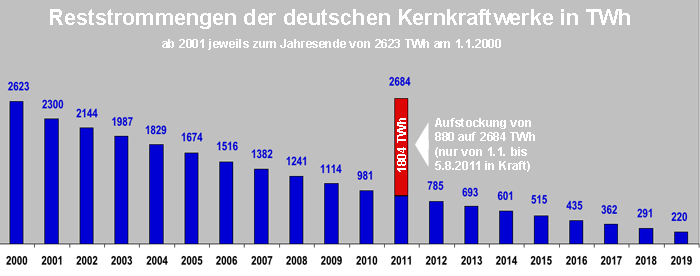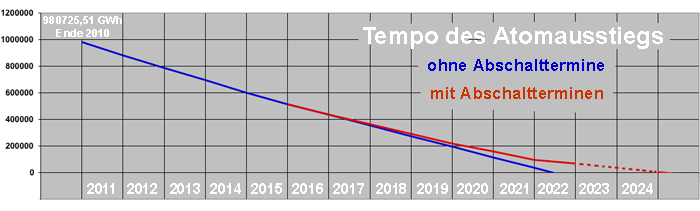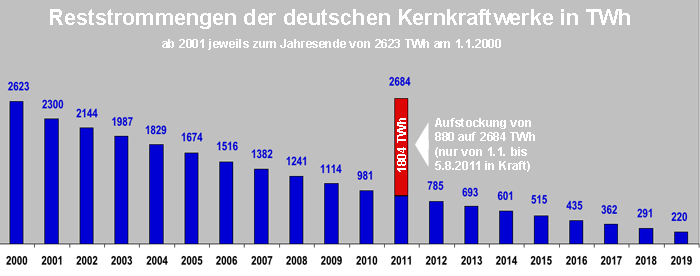 |
Die 2011 in Kraft getretene Aufstockung der Reststrommengen auf
2684 TWh hat deren Abarbeitung nicht beeinträchtigt, da sie nach
der Fukushima-Katastrophe zurückgenommen wurde. Die sofortige Stilllegung
von acht Kernkraftwerken und die Einführung von zusätzlichen
Abschaltterminen verzögerten jedoch ab diesem Zeitpunkt das Tempo
des Atomausstiegs erheblich. Andernfalls wäre schon 2018 der letzte
Reaktor stillgelegt worden.
|
Wieviel Pfusch will sich der Gesetzgeber noch leisten?
Eklatante Fehler bei der Novellierung des Atomgesetzes
verzögern und verteuern den Ausstieg aus der Kernenergie
(zu 201101)
Eigentlich ist es seit zwei Jahrzehnten geregelt und ganz einfach zu verstehen,
wie der deutsche Ausstieg aus der Kernenergie vonstatten gehen soll: Jedes der
19 Kernkraftwerke, die am 1. Januar 2000 in Betrieb waren, bekam eine bestimmte
Elektrizitätsmenge zugeteilt, die es ab diesem Datum noch erzeugen durfte.
Die kleinste entfiel auf den leistungsschwachen Reaktor Obrigheim aus dem Jahr
1969, der nur 8,7 Terawattstunden (TWh) zugeteilt bekam. Die größte
bekam mit 236,04 TWh der fünfmal leistungsstärkere Reaktor Neckarwestheim 2,
der 1989 als letztes deutsches Kernkraftwerk ans Netz gegangen war. Außerdem
hatte der RWE-Konzern bei den Verhandlungen über den Atomkonsens durchgesetzt,
dass ihm 107,25 Terawattstunden für den Reaktor Mülheim-Kärlich
zugestanden wurden, obwohl dieser Reaktor nur ein Jahr lang in Betrieb war und
wegen diverser Planungsfehler schon 1988 endgültig stillgelegt wurde (030906).
Reststrommengen sind Magna Charta des geordneten Ausstiegs
aus der Kernenergie
Insgesamt ergab das eine "Reststrommenge" von 2.623,31 TWh, die in
den folgenden Jahren sukzessive abgearbeitet wurde, nachdem die rot-grüne
Bundesregierung und die vier Atomkonzerne ihr im Juni 2000 erzieltes Verhandlungsergebnis
(000601) nochmals formell besiegelt hatten (010602)
und Anfang 2002 eine entsprechende Neufassung des Atomgesetzes in Kraft getreten
war (020404). Seitdem ist der erklärte Zweck des
Atomgesetzes nicht mehr, die Kernenergie zu fördern, sondern sie "geordnet
zu beenden". Und die vor zwanzig Jahren vereinbarten Reststrommengen sind
sozusagen die Magna Charta dieses geordneten Ausstiegs aus der Kernenergie.
KKW-Betreiber hielten sich nur pro forma an die Vereinbarungen
Bis Ende 2009 wurde so die vereinbarte Reststrommenge um 60 Prozent verringert.
Die Abarbeitung der restlichen 1.0391 TWh wäre wohl spätestens bis
2018 erfolgt. Aber leider waren weder die Atomkonzerne noch Union und FDP gewillt,
die mühsam erzielte Einigung zu respektieren. Die vier KKW-Betreiber E.ON,
RWE, Vattenfall und EnBW hielten sich zwar formell an die im Juni 2000 vereinbarte
Regelung und das darauf basierende Gesetz (041007).
Auch die Propaganda-Plattfom der gesamten Kernkraft-Lobby, das "Deutsche
Atomforum", verzichtete auf offene Stimmungsmache gegen die vereinbarte
Regelung. Inoffiziell gab es aber reichlich Spenden und sonstige Unterstützung
für Pro-Kernkraft-Initiativen, die aus dem Dunstkreis der Branche stammten,
ohne ihr unmittelbar zugerechnet werden zu können (170804).
Der E.ON-Konzern beauftragte sogar heimlich eine auf Politikberatung spezialisierte
PR-Agentur mit einem Strategiepapier, das Ratschläge enthielt, wie er die
öffentliche Meinung zugunsten der Kernenergie und damit das Ergebnis der
bevorstehenden Bundestagswahl beeinflussen könnte (090907).
Union und FDP betrieben von Anfang an die Rückgängigmachung
Union und FDP machten dagegen überhaupt keinen Hehl daraus, dass sie den
Atomausstieg sabotieren wollten. Sie hatten das neugefasste Atomgesetz schon
bei seiner Verabschiedung im Dezember 2001 entschieden abgelehnt und angekündigt,
den damit eingeleiteten Ausstieg im Falle eines Wahlsiegs wieder rückgängig
zu machen (011204). Die erste Chance dafür boten
die Bundestagswahlen im September 2005. Allerdings ergaben Meinungsumfragen,
dass die Mehrheit der Wähler den Atomausstieg durchaus für richtig
hielt. Realistischerweise verzichteten die beiden politischen Gehilfen der Atomkonzerne
deshalb auf die Forderung, das Verbot des Neubaus von Reaktoren aufzuheben.
Stattdessen verlangten sie vorläufig nur, die Laufzeiten aller Kernkraftwerke
– deren Anzahl inzwischen durch die Stilllegung von Stade (031107)
und Obrigheim (050503) auf 17 geschrumpft war –
kräftig zu verlängern (050502).
In der Großen Koalition hatte die Union keine Chance
zur Revision
Aber auch so blieb diese Forderung unpopulär genug. Die Bundestagswahl
vom September 2005 brachte jedenfalls nicht das erhoffte Ergebnis. Von den sechs
im Parlament vertretenen Parteien erzielten lediglich FDP und Linke Zugewinne,
während es für Unionsparteien, SPD und Grüne abwärts ging.
Die FDP dürfte ihren deutlichen Zuwachs von 7,4 auf 9,8 Prozent tatsächlich
der Kernenergie-Kampagne zu verdanken gehabt haben, denn diese Partei gebärdete
sich wie keine andere als Prätorianergarde der Atomwirtschaft. Die Stimmenverlagerung
kam jedoch größtenteils durch frühere Wähler der Unionsparteien
zustande und war insofern für die schwarz-gelbe Koalition ein Nullsummenspiel.
Weil das Wahlergebnis weder eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition noch
deren Ablösung durch eine schwarz-gelbe Koalition ermöglichte, kam
es zum ersten Mal seit vierzig Jahren erneut zu einer Großen Koalition
aus CDU, CSU und SPD. Die Unionsparteien mussten aber im Koalitionsvertrag von
vornherein die Bedingung der SPD akzeptieren, dass es in der neuen Legislaturperiode
keine Änderung des Atomgesetzes geben werde (051102).
Vier Kernkraftwerken drohte noch vor den Wahlen das Aus
Dies bedeutete, dass bis zur nächsten Bundestagswahl auch die Kernkraftwerke
Biblis A, Neckarwestheim 1, Biblis B und Brunsbüttel endgültig vom
Netz gehen würden, sofern ihre Laufzeit nicht durch die Übertragung
von Reststrommengen gemäß §
7 des Atomgesetzes verlängert würde (051001).
Grundsätzlich ließ das Atomgesetz eine derartige Übertragung
nur zu, wenn dadurch die Laufzeit älterer Anlagen verkürzt wurde.
Die Übertragung von jüngeren auf ältere Anlagen erforderte dagegen
eine ausdrückliche Genehmigung des zuständigen Bundesumweltministeriums.
Da die Betreiber der vier genannten Kernkraftwerke über keine älteren
Anlagen verfügten, waren sie also auf eine Genehmigung durch den Bundesumweltminister
Sigmar Gabriel (SPD) angewiesen, damit die vier Reaktoren so lange am Netz bleiben
konnten, bis das rettende Ufer eines politischen Machtwechsels erreicht war.
Allerdings verfügte der RWE-Konzern noch über das Sonderkontingent,
das ihm bei den Verhandlungen über den Atomkonsens für den Reaktor
Mülheim-Kärlich zugestanden wurde. Laut Atomgesetz durften davon bis
zu 21,45 TWh auf Biblis B übertragen werden. Ferner war die Übertragung
in unbeschränkter Höhe auf Emsland, Neckarwestheim 2, Isar 2, Brokdorf
sowie Gundremmingen B und C erlaubt. Insoweit drohte in Biblis nur dem Block
A ernsthaft die Abschaltung, bevor das rettende Ufer eines politischen Machtwechsels
erreicht werden konnte. Um auch für Biblis A, Neckarwestheim und Brunsbüttel
die Reststrommengen aufstocken zu können, gingen RWE, Vattenfall und EnBW
in einer konzertierten Aktion vor: Zunächst stellte RWE beim Bundesumweltministerium
den Antrag, die Übertragung von 30 TWh aus der Reststrommenge für
Mülheim-Kärlich auf Biblis A zu genehmigen. Weil das laut Atomgesetz
ausdrücklich nicht erlaubt war, beantragte RWE zugleich und ersatzweise
eine Übertragung vom jüngeren Kernkraftwerk Emsland, dessen Reststrommenge
aus dem Kontingent für Mülheim-Kärlich problemlos aufgestockt
werden konnte (060901). Ein Vierteljahr später
beantragte die EnBW für Neckarwestheim 1 die Übertragung von 46,9
TWh von ihrem jüngeren Reaktor Neckarwestheim 2 (061202).
Noch ein Vierteljahr später zog Vattenfall nach und wollte 15 TWh aus dem
Kontingent für Mülheim-Kärlich auf Brunsbüttel übertragen
lassen (070303).
Mit allerlei Tricks brachten die KKW-Betreiber ihre Reaktoren
über die Runden
Umweltminister Sigmar Gabriel (SPD) lehnte erwartungsgemäß alle
drei Anträge ab (080401, 080604,
090508). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte
anschließend, dass die geplanten Übertragungen von Mülheim-Kärlich
auf Biblis A und Brunsbüttel nach dem Atomgesetz gar nicht zulässig
gewesen wären (090313). Trotzdem musste keiner
der vier Reaktoren vor den Bundestagswahlen abgeschaltet werden. Es kam nämlich
– wie der Zufall es so wollte– plötzlich zu unerwarteten Stillständen:
Die beiden Blöcke in Biblis wurden im Oktober 2006 wegen falsch ausgeführter
Nachrüstungsmaßnahmen zum Schutz vor Erdbeben abgeschaltet (061006).
Der Reaktor B, der noch über ein größeres Reststrom-Polster
verfügte, durfte ein paar Wochen später wieder den Betrieb aufnehmen,
nachdem die falsch montierten Dübel ausgetauscht waren (071109).
Der Reaktor A blieb aber aus demselben Grund ganze 16 Monate abgeschaltet, bevor
er Mitte Februar 2008 wieder ans Netz ging (080210).
Ähnliches Glück im Unglück hatte Vattenfall, als es im Kernkraftwerk
Brunsbüttel in einer Schaltanlage außerhalb des nuklearen Teils zu
einem Kurzschluss kam, der die automatische Abschaltung des Reaktors bewirkte
(070608). Normalerweise wäre der Reaktor schnell
wieder am Netz gewesen. Seltsamerweise dauerte der Stillstand aber nicht nur
Tage, sondern viele Monate. Als erfreulicher Nebeneffekt für Vattenfall
blieb dadurch die Reststrommenge unverändert bei 10.999,67 GWh, was bei
normaler Fahrweise nur noch bis Anfang 2009 gereicht hätte. Der EnBW gelang
es plötzlich auch nicht mehr, das Kernkraftwerk Neckarwestheim 1 in der
gewohnten Weise zu betreiben. Bis 2006 hatte dieser Reaktor im Jahresdurchschnitt
eine jährliche Elektrizitätsmenge von 6.055,5 GWh erzeugt. Nun waren
es 2007 nur noch 4.713,53 GWh. Im folgenden Jahr waren es sogar nur noch rund
3.800 Gigawattstunden. Im Juli 2008 verfügte er deshalb noch immer über
mehr als 10.0000 GWh, mit denen er gut bis nach den Bundestagswahlen im September
2009 über die Runden kommen konnte. Die EnBW begründete die Drosselung
der Stromproduktion mit Wartungsarbeiten und der wirtschaftlichen Optimierung
des Kraftwerksparks.
Schwarz-gelbe Koalition spendierte Laufzeitverlängerungen
bis zu 14 Jahren
So gelang es RWE, Vattenfall und EnBW, die vier Reaktoren Biblis A und B, Brunsbüttel
und Neckarwestheim 1 am Netz zu belassen, obwohl deren Reststrommengen bei normaler
Betriebsweise schon 2009 erschöpft gewesen wären. Es dauerte dann
auch nicht lange, bis die schwarz-gelbe Koalition ihr Wahlversprechen einlöste
und im Rahmen eines "Energiekonzepts", das sie im September 2010 vorlegte
(100902), allen 17 Kernkraftwerken eine Laufzeitverlängerung
um durchschnittlich zwölf Jahre spendierte (100901).
Die Regierung verschwieg zunächst, dass dieser Teil ihres Energiekonzepts
das Ergebnis einer Vereinbarung mit den vier Atomkonzernen war. Die Mitverfasser
wurden aber zufällig bekannt, weil sich das RWE-Vorstandsmitglied Rolf-Martin
Schmitz bei einer Pressekonferenz verplapperte und das gemeinsame Papier erwähnte
(100901). Am 28. Oktober 2010 billigte dann auch die
Regierungsmehrheit des Bundestags unter heftigem Protest der Oppositionsparteien
die Neufassung des Atomgesetzes, welche die Reststrommengen gemäß
der Anlage 3 so erhöhte,
dass dadurch die Laufzeiten der zehn neueren Reaktoren um 14 Jahre und die der
sieben ältesten um jeweils acht Jahre verlängert wurden (101002).
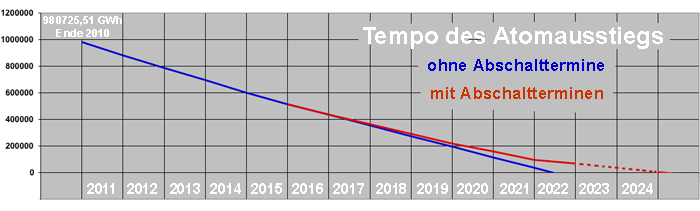 |
Entgegen landläufiger Ansicht bewirken die Abschalttermine, die der
Reststrommengen-Regelung im Jahr 2011 hinzugefügt wurden, keineswegs
eine Beschleunigung des Ausstiegs aus der Kernenergie, sondern dessen
Verzögerung (Differenz zwischen blauer und roter Linie ab 2016).
Die blaue Linie macht deutlich, dass ohne die Abschalttermine alle Reststrommengen
schon Mitte 2022 entschädigungslos abgearbeitet wären. Die rote
Linie endet dagegen beim letzten Abschalttermin 31. Dezember 2022, wobei
eine unverstromte Elektrizitätsmenge von etwa 66000 Gigawattstunden
übrig bleibt, die entschädigungspflichtig ist. Ihre gepunktete
Fortführung zeigt, dass die drei letzten Reaktoren bei einem Weiterbetrieb
noch gut zwei Jahre zur Verstromung der Reststrommengen benötigen
würden. |
Atompolitische Kehrtwende nach der Katastrophe von Fukushima
Schon zehn Wochen nach Inkrafttreten der Neuregelung (101214)
ereignete sich dann aber in Japan die zweite große Kernkraft-Katastrophe
nach Tschernobyl (110301): Am 11. März 2011 zerstörten
ein Erdbeben und die dadurch ausgelöste Flutwelle vier der sechs Reaktoren
des Kernkraftwerks Fukushima. In den folgenden Tagen kam es zu Explosionen und
zur Kernschmelze der Brennstäbe. Ähnlich wie 1986 in der Sowjetunion
begann damit ein jahrelanges Drama mit der Freisetzung großer Mengen an
Radioaktivität und mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die Energiepolitik
in Deutschland: Die schwarz-gelbe Bundesregierung, die eben erst die Laufzeiten
der Kernkraftwerke großzügig verlängert hatte, vollzog nun binnen
weniger Wochen eine atompolitische Kehrtwende. Vorab beschloß sie am 14.
März – also am dritten Tag nach Beginn der Katastrophe – die
vorläufige Abschaltung bzw. Nichtwiederinbetriebnahme der sieben ältesten
deutschen Kernkraftwerke. Dieses "Moratorium" war auf drei Monate
befristet und mit einer Sicherheitsüberprüfung aller 17 Kernkraftwerke
verbunden. Der Beschluß wurde am folgenden Tag mit den CDU-Ministerpräsidenten
der betroffenen Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen
und Schleswig-Holstein abgestimmt und bis zum 18. März über entsprechende
Anordnungen der atomrechtlichen Landesaufsichtsbehöden umgesetzt.
Theaterdonner mit rechtswidrigen und sachlich unbegründeten
Abschaltungen
Letztendlich handelte es sich dabei um Theaterdonner, dessen Rechtswidrigkeit
nachträglich über alle Instanzen der Verwaltungsgerichtsbarkeit festgestellt
wurde (130214, 140110). Aber
auch sachlich gab es keinen vernünftigen Grund, in Deutschland die sieben
ältesten Kernkraftwerke schlagartig vom Netz zu nehmen, weil ein Kernkraftwerk
am Pazifischen Ozean einem Erdbeben und einer dadurch ausgelösten Flutwelle
nicht standhalten konnte. Vielmehr bedeutete dies eine Gefährdung der Versorgungssicherheit.
Die leistungsstarken Kernkraftwerke waren nun mal so etwas wie die Ecksteine
in der Architektur des deutschen Übertragungsnetzes. Man konnte sie nicht
einfach aus dieser Architektur herausbrechen, ohne das ganze System zu destabilisieren.
Es ging dabei keineswegs allein um die Stromerzeugung. Die plötzlich entfallende
Wirkleistung von fünf Kernkraftwerken – zwei der sieben waren ohnehin
abgeschaltet – ließ sich ja durch Stromimporte und das Hochfahren
anderer Erzeugungskapazitäten noch kompensieren. Aber für die Blindleistung,
die von diesen Kernkraftwerken an den Knotenpunkten des Netzes bereitgestellt
wurde, gab es keinen entsprechenden Ersatz. Deshalb mußte zum Beispiel
im abgeschalteten Kernkraftwerk Biblis A der Generator für sieben Millionen
Euro so umgebaut werden, daß er weiterhin am Netz bleiben und Blindleistung
einspeisen konnte (siehe Hintergrund, Februar 2015).
Regierung hielt sich vorerst alle Handlungsmöglichkeiten
offen
Dieser willkürliche und sachlich unbegründete, aber bombastische
Theaterdonner mit der sofortigen Abschaltung der ältesten Reaktoren dürfte
zunächst keinen anderen Zweck verfolgt haben, als die Wahlergebnisse zugunsten
von Union und FDP zu beeinflussen. Er war sichtlich darauf angelegt, der schwarz-gelben
Regierung kurz vor den anstehenden drei Landtagswahlen den Rücken in Sachen
Kernenergie freizuhalten. Das Moratorium war insofern eine Luftnummer, als es
der Bundesregierung alle Handlungsmöglichkeiten offen ließ. Es wäre
jedenfalls voreilig, darin eine Art Vorstufe und Ankündigung der später
erfolgten Rücknahme der Laufzeiten-Verlängerung zu sehen. In Wirklichkeit
verpflichtete es die Bundesregierung zu gar nichts. Die einzige Verpflichtung
bestand darin, sämtliche deutschen Kernkraftwerke einer Überprüfung
durch die Reaktorsicherheitskommission zu unterziehen. Aber auch das war eine
Luftnummer, weil das Ergebnis so vorhersehbar war wie das Amen in der Kirche.
Es war nicht damit zu rechnen, daß sich bei einem der 17 deutschen Kernkraftwerke
– ob älteren oder neueren Datums – eine gravierende Beanstandung
ergeben würde. Das bis 15. Juni befristete Moratorium enthielt deshalb
ein doppeltes Verfallsdatum: Spätestens nach Vorliegen der Unbedenklichkeitsbescheinigungen
hätten auch die ältesten Kernkraftwerke wieder ans Netz gehen und
ihre verlängerten Laufzeiten voll ausschöpfen können.
78 Prozent der Wähler glaubten an ein wahltaktisches Manöver
Erst Ende März war es dann mit der wortradikalen Unverbindlichkeit vorbei.
Die Landtagswahlen hatten gezeigt, daß auch die Wählerschaft dem
atompolitischen Kurswechsel der Kanzlerin nicht über den Weg traute. In
Sachsen-Anhalt flog am 20. März die Atompartei FDP aus dem Landtag, und
der Stimmenanteil der CDU sank von 36,2 auf 32,5 Prozent. Noch viel schlimmer
kam es eine Woche später in Baden-Württemberg, wo die CDU seit fast
sechzig Jahren ununterbrochen regiert hatte: Sie verlor massenhaft Wähler
an die Grünen, die zur zweitstärksten Partei wurden und nun mit der
SPD als Koalitionspartner zum ersten Mal in einem Bundesland den Ministerpräsidenten
stellen konnten. Die FDP büßte in ihrem vermeintlichen "Stammland"
5,4 Prozent ein und kam nur noch knapp über die Fünf-Prozent-Hürde
hinweg. Dieses Debakel war in erster Linie auf die Unglaubwürdigkeit der
schwarz-gelben Atompolitik zurückzuführen. Eine Umfrage von Infratest
Dimap ergab, daß 78 Prozent der Wähler an ein wahltaktisches Manöver
glaubten.
Rückkehr zur alten Regelung wurde mit scheinradikalen
Zutaten aufgepeppt
Nun mussten Nägel mit Köpfen gemacht werden, um die Wähler zu
beeindrucken. Zumindest sollte es so aussehen. Insofern war es konsequent, wenn
die schwarz-gelbe Regierung nun beschloss, das unnötige, technisch grob
fahrlässige und hinzu auch noch rechtswidrige Moratorium vom Ruch eines
wahltaktisch bedingten Manövers zu befreien. Diese Flucht nach vorn konnte
natürlich nicht gelingen, wenn an der Laufzeiten-Verlängerung festgehalten
wurde. Sie sollte aber keinesfalls wie eine einfache Rückkehr zur alten
Ausstiegsregelung aussehen. Deshalb enthielt der Gesetzentwurf, den die Koalition
jetzt ausarbeiten ließ, noch zwei Zutaten: Zum einen waren das feste Schlußtermine,
bis zu denen die bestehenden Kernkraftwerke die ihnen aufgrund der wiederhergestellten
alten Reststrommengen-Regelung zustehenden Gigawattstunden abgearbeitet haben
müssen. Zum anderen durften die sieben Kernkraftwerke, die unter das Moratorium
fielen, sowie das Kernkraftwerk Krümmel nicht mehr ans Netz gehen, sondern
mußten abgeschaltet bleiben. Bis Ende 2022 sollte so der Atomausstieg
restlos vollzogen sein (110501).
Beide Zutaten klangen wieder ziemlich radikal, gerade so, als ob sich nun die
Union beim Ausstieg aus der Kernenergie an die Spitze gesetzt hätte. Sie
änderten aber grundsätzlich nichts am Mengengerüst der alten
Ausstiegsregelung. Die Schlußtermine waren sichtlich so kalkuliert worden
– oder sollten es zumindest sein – , daß sie den KKW-Betreibern
bei einem konzernübergreifenden Ausgleich die Abarbeitung aller Reststrommengen
erlaubt hätten (110601). Von den acht Reaktoren,
die nicht mehr ans Netz gehen durften, hätten sieben sowieso bald stillgelegt
werden müssen. Soweit sie noch über Reststrommengen verfügten,
konnten diese wie bisher auf andere Kernkraftwerke übertragen werden. Rätselhaft
blieb, weshalb auch der relativ neue Reaktor Krümmel der alten Moratoriums-Liste
hinzugefügt worden war. Möglicherweise hatte es mit dem bislang unbestätigten
Vorwurf zu tun, er sei für eine Häufung von Leukämie-Fällen
in der Elbmarsch verantwortlich (siehe Link-Liste).
Als Folge dieses blindwütigen gesetzgeberischen Kahlschlags hatte der Vattenfall-Konzern,
der die beiden Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel betrieb, überhaupt
keine Gelegenheit mehr, die noch unverbrauchten Reststrommengen von insgesamt
knapp hunderttausend Gigawattstunden selber abzuarbeiten. Er war deshalb darauf
angewiesen, dass ihm diese Mengen von den drei noch verbliebenen aktiven KKW-Betreibern
abgekauft wurden. Das Gesetz enthielt aber keinerlei Regelungen, wie das vor
sich gehen sollte und zu welchen Konditionen.
Keine der Oppositionsparteien erkannte die Tücken der
Schlusstermine
Nur die Linke lehnte den Gesetzentwurf ab und begründete dies mit dem
stichhaltigen Argument, dass er bestenfalls der alten Ausstiegsregelung entspreche.
SPD und Grüne stimmten jedoch für ihn. Sie bedauerten lediglich, daß
er den Ausstieg aus der Kernenergie noch nicht schnell genug vorantreibe. Vor
allem bei den Grünen drängte eine starke Minderheit auf einen früheren
Ausstieg, weshalb sich die Bundestagsfraktion auf einem eigens einberufenen
Sonderparteitag ausdrücklich zur Zustimmung ermächtigen ließ
(110601). Keine der drei Oppositionsparteien kritisierte
aber den eigentlichen wunden Punkt des Gesetzes, der sich aus dem Konflikt zwischen
der Reststrommengen-Regelung und den übergestülpten Abschaltterminen
für die einzelnen Reaktoren ergab. Die Grünen-Fraktion glaubte sogar,
in dieser Hinsicht die Regierungsparteien noch überbieten zu müssen,
indem sie den Antrag stellte, die Liste der sofort stillzulegenden Kernkraftwerke
um den Reaktor Grafenrheinfeld zu erweitern und die verbleibenden acht Reaktoren
schon bis 15. April 2017 stillzulegen. Den Verfassern dieses Schaufenster-Antrags
schien überhaupt nicht zu dämmern, dass das Vorziehen der Schlusstermine
die Abarbeitung der Reststrommengen noch mehr behindern und immense Entschädigungs-Forderungen
entstehen lassen würde. Dasselbe galt für die unsinnige Forderung,
die Liste der Sofort-Abschaltungen um den Reaktor Grafenrheinfeld zu vermehren:
Jede Abschaltung musste logischerweise die Kapazitäten zur Abarbeitung
der Reststrommengen verringern und den dafür erforderlichen Zeitraum verlängern.
Zugleich wurden damit den KKW-Betreibern hohe Entschädigungsansprüche
zugeschanzt, sofern sich nicht alles im Rahmen des geordneten Ausstiegs aus
der Kernenergie unterbringen ließ, wie er vor zehn Jahren von KKW-Betreibern
und Bundesregierung vereinbart wurde.
Konzernübergreifender Ausgleich der Reststrommengen wurde
unterstellt, aber nicht geregelt
Dasselbe Problem ergab sich schon beim Regierungsentwurf, dessen Abschalttermine
unter stärkerer Berücksichtigung der Reststrom-Guthaben kalkuliert
wurden. Sie wären im Idealfall eine überflüssige propagandistische
Zutat gewesen, die bei jeder KKW-Abschaltung einen hübschen medialen Knalleffekt
erzeugt hätte, ohne die komplette Abarbeitung der Elektrizitätsmengen
zu behindern oder sonst irgendwelchen Schaden anzurichten. Die Urheber hatten
es aber versäumt, den konzernübergreifenden Ausgleich, von dem sie
offenbar ausgingen, auch im Gesetz zu verankern. So blieb ein großes Fragezeichen
hinter den Reststrommengen für Brunsbüttel und Krümmel, die Vattenfall
beanspruchen konnte und für die theoretisch noch genug Platz im Budget
von E.ON und EnBW gewesen wäre. Außerdem war für RWE das Budget
zu knapp bemessen, um die komplette Abarbeitung des großen Kontingents
für Mülheim-Kärlich zu ermöglichen. Anscheinend ging man
davon aus, dass die KKW-Betreiber sich schon irgendwie einigen und gegebenenfalls
auf ein paar Gigawattstunden verzichten würden, falls ihre Vereinbarung
mit der Bundesregierung aus dem Jahr 2001 mit dem geänderten Atomgesetz
kollidieren sollte. Indessen gab es nicht einmal eine diesbezügliche Vorabklärung
und Absprache mit den KKW-Betreibern, die ein unbefangener Leser des Gesetzestextes
spontan vermuten musste – denn für so dämlich konnte er den
Gesetzgeber eigentlich nicht halten.
Abschalttermine sind verfassungswidrig, wenn sie die Abarbeitung
der Reststrommengen verhindern
Das war aber ein Irrtum. Der Gesetzgeber war tatsächlich so dämlich
gewesen und empfing dafür am 6. Dezember 2016 die Quittung: Das Bundesverfassungsgericht
gab einer Klage der KKW-Betreiber statt und verpflichtete die inzwischen regierende
Große Koalition aus Union und SPD zur Änderung der 13. Atomgesetz-Novelle,
weil die Schlußtermine für die sukzessive Abschaltung aller Reaktoren
in § 7 Abs. 1a zu knapp bemessen
seien, um die zugesicherten Reststrommengen restlos abarbeiten zu können.
Ferner vermissten die Karlsruher Richter eine Regelung, welche die KKW-Betreiber
für den Ankauf von Brennelementen oder ähnliche Investitionen entschädigt,
die sie im Vertrauen auf die Dauerhaftigkeit der Laufzeiten-Verlängerung
vorgenommen hätten, die ihnen die schwarz-gelbe Koalition erst kurz zuvor
beschert hatte. In beiden Fällen werde das in Artikel 14 des Grundgesetzes
verankerte Recht auf Eigentum verletzt. Das Atomgesetz müsse deshalb bis
zum 30. Juni 2018 in den beanstandeten Punkten revidiert werden (161201,
siehe auch Hintergrund, Dezember 2016).
Die Karlsruher Richter verbanden ihre Ohrfeige für den Gesetzgeber mit
einem diskreten Hinweis, wie er am besten aus der Affäre herauskommen könne:
Indem er die Abschalttermine einfach streicht. Die Abarbeitung der Reststrommengen
wäre dann problemlos möglich gewesen und bei konzernübergreifendem
Ausgleich sogar schneller vonstatten gegangen. Außerdem hätte sich
zugleich der weitere verfassungswidrige Mangel des Gesetzes erledigt, der im
Fehlen einer Entschädigungsregelung für nicht verstromte Elektrizitätsmengen
bestand. Die Einführung einer solchen Regelung wäre zwar der Ordnung
halber weiter nötig geblieben. Zur Anwendung gelangt wäre sie aber
nie, weil es keine unverstromten Mengen gegeben hätte.
Schwarz-rote Koalition wollte unbedingt an Schlussterminen
festhalten
Man hörte dann fast eineinhalb Jahre nichts davon, wie die schwarz-rote
Koalition – die nach den Bundestagswahlen vom September 2017 wider Erwarten
doch fortgesetzt wurde – , sich des Auftrages aus Karlsruhe entledigen
würde. Vermutlich war eine entsprechende Gesetzesvorlage schon von der
Vorgänger-Koalition ausgearbeitet worden. Das könnte erklären,
weshalb der im Februar 2018 erneut zustande gekommene Koalitionsvertrag diesen
heiklen Punkt überhaupt nicht erwähnte, obwohl die vom Bundesverfassungsgericht
gesetzte Frist für die Gesetzesänderung schon in fünf Monaten
ablief (180206). Anscheinend gab es
keinen Abstimmungsbedarf mehr, weil ein entsprechendes Papier griffbereit in
der Schublade lag. Als die Linke-Fraktion im Bundestag nach dem Stand der Dinge
fragte, beschränkte sich die Regierung auf die Auskunft, dass sie die Umsetzung
des Karlsruher Urteils prüfe und dass in jedem Fall an den Schlussterminen
für die Abschaltung der einzelnen Kernkraftwerke festgehalten werde (180202).
Damit war jene grob fahrlässige Weichenstellung vorgezeichnet, die jetzt
den gesetzgeberischen Zug erneut entgleisen ließ. Denn genau diese Schlusstermine
hatte das Bundesverfassungsgericht als unvereinbar mit den gesetzlich verankerten
Reststrommengen bezeichnet, auf deren Abarbeitung die KKW-Betreiber einen Anspruch
hatten und noch haben. Dieser Anspruch besitzt rechtlich eine besondere Qualität,
weil er auf jener Vereinbarung basiert, die im Juni 2000 zwischen der Bundesregierung
und den vier Atomkonzernen zustande kam und ein Jahr später formell besiegelt
wurde. Die Abschalttermine für die einzelnen Kernkraftwerke, mit denen
die schwarz-gelbe Koalition ihre Rückkehr zur alten Reststrommengen-Regelung
zu kaschieren versuchte, waren dagegen von Anfang an propagandistische Augenwischerei
und bestenfalls überflüssig. Sie gehörten zu den scheinradikalen
Zutaten, mit denen Union und FDP nach der Katastrophe von Fukushima vergessen
machen wollten, dass sie soeben noch die Laufzeiten aller deutschen Kernkraftwerke
um bis zu 14 Jahre verlängert hatten.
Über Einzelheiten des endgültigen Textes scheint es innerhalb der
Koalition Differenzen gegeben zu haben. Jedenfalls beschloss das Kabinett erst
am 23. Mai 2018 den Gesetzentwurf, der bis zum 30. Juni vom Parlament verabschiedet
werden musste, um die von den Karlsruher Richtern gesetzte Frist einzuhalten.
Am 1. Juni gelangte die Regierungsvorlage ins Parlament, wo die Fraktionen von
Union und SPD einen gleichlautenden Antrag einbrachten, den sie am 28. Juni
mit ihren Stimmen verabschiedeten, während der Regierungsentwurf für
erledigt erklärt wurde (180601).
Nur der FDP fiel die Schlampigkeit des Gesetzentwurfs auf
Die Reparatur-Novelle wurde zwar von allen vier Oppositionsparteien abgelehnt,
aber von FDP, Linken und Grünen inhaltlich mitgetragen. Das kam vor allem
bei der ersten Lesung des Gesetzwurfs am 8. Juni zum Ausdruck. Auch in der zweiten
und dritten Lesung am 28. Juni 2018 übten die demokratischen Oppositionsparteien
keinerlei Kritik an den echten Schwachpunkten des Gesetzes. Vor allem stimmten
sie mit der schwarz-roten Regierung darin überein, dass an den Abschaltterminen
nicht gerüttelt werden dürfe und deshalb die ab 2023 anfallenden Entschädigungszahlungen
an die KKW-Betreiber die einzig richtige Lösung seien. Stattdessen suchten
sie mühsam nach Begründungen, weshalb sie das Gesetz doch ablehnen
müssten. Am elegantesten zog sich dabei die FDP aus der Affäre: Die
Abgeordnete Judith Skudelny, die als Berichterstatterin im zuständigen
Ausschuss saß, verwies völlig zu Recht darauf, dass der Gesetzentwurf
in mehreren Punkten "handwerklich nicht gut ist". Beispielsweise bleibe
unklar, wie die Entschädigungen zu berechnen seien und in welchem Umfang
die KKW-Betreiber kooperieren müssen. Hier eröffne sich ein "Einfallstor
für neue Streitigkeiten". Ihre Partei werde deshalb nicht zustimmen
– "nicht weil die Intention falsch ist, sondern weil der Weg, der
gewählt worden ist, nicht korrekt ist".
Auch Linke und Grüne huldigten blind dem Fetisch Schlusstermine
Den Berichterstattern von Linken und Grünen war dagegen die Schlampigkeit
des Gesetzentwurfs nicht einmal aufgefallen. Um die anfallenden Kosten für
die Entschädigung der KKW-Betreiber zu rechtfertigen, erweckten sie den
falschen Eindruck, als ob die Substanz des Atomausstiegs gefährdet sei,
wenn auf die Abschalttermine verzichtet werde. Der Linke-Abgeordnete Hubertus
Zdebel hielt es sogar für "alarmierend", dass in den Reihen der
Regierungskoalition zeitweilig überhaupt daran gedacht worden sei, eine
Revision der falsch gesetzten Schlusstermine in Erwägung zu ziehen. Damit
sei nichts weniger als der ganze Atomkonsens in Frage gestellt worden. Dahinter
habe der Wirtschaftsflügel der CDU gesteckt. Allerdings sei die vorgesehene
Entschädigung zu großzügig bemessen. Deshalb fordere die Linke
einen "Gemeinwohlabschlag in Höhe von 10 bis 15 Prozent" und
werde den Gesetzentwurf ablehnen.
Die Grünen-Berichterstatterin Sylvia Kotting-Uhl wollte ebenfalls nicht
an den Schlussterminen rütteln lassen und vermißte einen "Gemeinwohlabschlag"
an den Entschädigungen, die sich zwangsläufig daraus ergeben. Außerdem
sei es nicht gelungen, den Gesetzentwurf um eine Passage zu ergänzen, welche
die Übertragung von Reststrommengen auf die Kernkraftwerke Brokdorf und
Emsland untersagt. Der von diesen Reaktoren erzeugte Atomstrom verstopfe nämlich
im Norden das Netz. Die dadurch bewirkte Abregelung von Windstrom gehe zu Lasten
der "Steuerzahlerinnen und Steuerzahler", wie sie in politisch korrektem
Gender-Neudeutsch, aber mit ziemlich schiefer Logik formulierte.
Lachender Dritter war die rechtsextremistische AfD
Die drei Oppositionsparteien FDP, Linke und Grüne unterstützten so
uneingeschränkt das Festhalten an den unsinnigen Abschaltterminen, obwohl
sie das Gesetz mit jeweils unterschiedlichen Begründungen ablehnten. Die
beste Figur machte noch die FDP, indem sie auf den gesetzgeberischen Pfusch
verwies, den später das Bundesverfassungsgericht rügte. Linke und
Grüne wollten dagegen diesen Pfusch eher noch vergrößern. Das
gilt vor allem für den ominösen "Gemeinwohlabschlag" zur
Senkung der Kosten, die sie mit ihrem gemeinwohlschädlichen Festhalten
an den Abschaltterminen überhaupt erst verursachten. Die von der Grünen-Sprecherin
verlangte Revision der Reststrommengen-Regelung hätte einer Überprüfung
durch das Bundesverfassungsgericht mit ziemlicher Sicherheit ebenfalls nicht
standgehalten. Zumindest hätte das vorzeitige Ausscheiden von Brokdorf
und Emsland aus der Abarbeitung der Reststrommengen die Entschädigungszahlungen
zu Lasten der "Steuerzahlerinnen und Steuerzahler" noch stark vergrößert.
Am schlimmsten aber war: Alle fünf Fraktionen der demokratischen Parteien
überließen es so der rechtsextremistischen AfD, auf die überaus
fragwürdige "Kosten-Nutzen-Rechnung" hinzuweisen und sich als
Anwalt des Steuerzahlers aufzuspielen. "Diese Kosten-Nutzen-Rechnung ist
von den Initiatoren bewusst nicht unternommen worden", tönte der AfD-Abgeordnete
Rainer Kraft. "Wir müssen daher konstatieren, dass von der Union und
der SPD der Ideologie des Ausstieges aus der nukleartechnischen Stromerzeugung
der Vorzug gegeben wird vor einer gewissenhaften Prüfung der volkswirtschaftlichen
Konsequenzen Ihres Gesetzentwurfs, in diesem Falle zum Nachteil des Steuerzahlers
mit möglichen Kosten im oberen dreistelligen Millionenbereich."
Mogelpackung wurde parteiübergreifend zum Garanten des
Atomausstiegs verklärt
In der Tat blieben alle fünf demokratischen Fraktionen eine überzeugende
Antwort schuldig, weshalb sie nicht endlich die Beseitigung der Abschalttermine
verlangten, sondern geradezu fanatisch an ihnen festhielten, als ob andernfalls
der Atomausstieg gefährdet sei. Auf diese Weise verteidigten und glorifizierten
sie eine Mogelpackung, die von Anfang an den Atomausstieg verzögerte anstatt
ihn zu beschleunigen. Inzwischen stand sogar fest, dass sich aus dieser Mogelpackung
Entschädigungszahlungen an die KKW-Betreiber ergeben mussten. Das Bundesverfassungsgericht
hatte deshalb schon in seinem Urteil vom Dezember 2016 deutlich gemacht, dass
die Abschalttermine so überflüssig wie ein Kropf sind und ihre Streichung
die einfachste Lösung wäre. Hätte der Bundestag diese Empfehlung
beherzigt, wären keinerlei Entschädigungszahlungen entstanden und
die drei letzten Reaktoren allenfalls ein paar Wochen länger gelaufen (siehe
Hintergrund, Mai 2018).
Weshalb folgte der Bundestag dieser Empfehlung nicht? – Bei Union und
FDP versteht man das ja noch einigermaßen, da sie die Erfinder dieser
Mogelpackung waren. Bei SPD und Grünen schon weniger. Diese beiden Oppositionsparteien
haben zwar 2011 ebenfalls für die schwarz-gelbe Novellierung des Atomgesetzes
gestimmt. Vermutlich hatte das viel mit schlichter Ignoranz zu tun, denn die
fatalen Konsequenzen der scheinradikalen Zutaten erschlossen sich nicht auf
den ersten Blick. Zumindest den wenigen Experten, die sich in der Materie auskannten,
dürfte aber klar gewesen sein, dass die Sofort-Stilllegung von acht Kernkraftwerken
sowie die Hinzufügung von willkürlichen Abschaltterminen für
die restlichen Reaktoren die Kraftwerkskapazitäten zur Abarbeitung der
Reststrommengen mindern musste. Logischerweise ergab sich so keine Beschleunigung
des Atomausstiegs, sondern dessen Verzögerung. Die Aufdeckung dieses frommen
Betrugs war allerdings auch 2018 noch schwer zu vermitteln. Die Wahrheit ist
nun mal kein Selbstläufer, sondern gelangt erst durch den teilweise sehr
unsauberen Filter der Massenmedien in die Köpfe. Wer als Politiker diesen
Schwindel angesprochen hätte, wäre deshalb ein hohes Risiko eingegangen,
nicht als Aufklärer gefeiert zu werden, sondern als Häretiker wider
die reine Lehre vom Atomausstieg auf dem Scheiterhaufen der öffentlichen
Meinung verbrannt zu werden. Außerdem hätte es nun für die SPD
bedeutet, sich mit den Koalitionspartnern CDU und CSU anzulegen. So kam zur
Ignoranz noch eine gehörige Portion Opportunismus hinzu.
Am ehesten hätte man der Linken zugetraut, die Sache rational anzugehen,
nachdem diese 2011 als einzige Fraktion gegen die schwarz-gelbe Novellierung
des Atomgesetzes gestimmt und dies damit begründet hatte, dass sie allenfalls
der alten Ausstiegsregelung entspreche. Daran hätte die Partei im Juni
2018 anknüpfen können, um nach sieben Jahren festzustellen, dass die
Novellierung leider noch schlechter als die alte Ausstiegsregelung war. –
Und um der Regierung maliziös zu gratulieren, dass sie zeitweilig doch
in einem Anfall von Vernunft überlegt habe, den vom Bundesverfassungsgericht
gewiesenen Weg zu beschreiten und die Abschalttermine ersatzlos zu streichen.
Stattdessen fand der Linken-Sprecher Hubertus Zdebel solche angeblichen Überlegungen
äußerst "alarmierend" und sah dadurch den ganzen Atomausstieg
gefährdet. Er vermutete auch nicht die Autorität des Bundesverfassungsgerichts
dahinter, sondern erkannte mit linksdogmatisch geschultem Scharfsinn, dass hier
der Wirtschaftsflügel der Union seinen Einfluß geltend gemacht habe.
Es ist leider zu befürchten, dass dieses Trauerspiel nun weitergeht, nachdem
das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber zum zweiten Mal zum Nachsitzen
verdonnert hat.