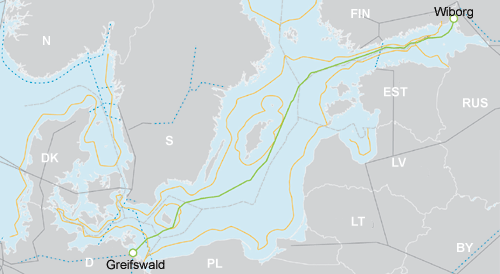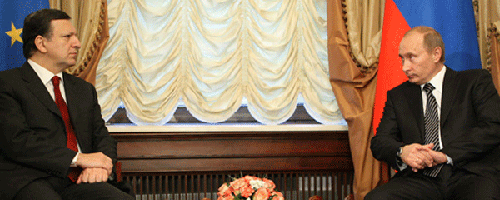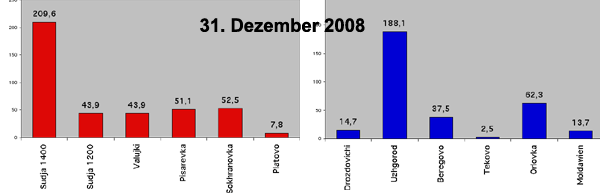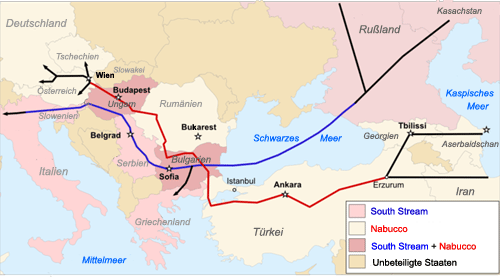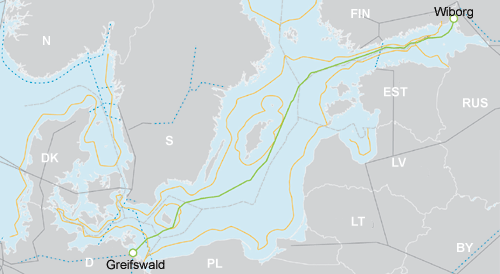 |
Die Ostsee-Pipeline "Nord Stream" (grün) verläuft fast durchweg
außerhalb der nationalen Hoheitsgewässer (gelbe Linien). Aber auch in den
sogenannten Ausschließlichen Wirtschaftszonen (grau strichelt) haben die Anrainerstaaten
mitzureden. Weil die baltischen Staaten und Polen ihre Zustimmung verweigerten, war
es für Rußland sehr wichtig, von Finnland, Schweden und Dänemark die
Erlaubnis zur Verlegung der Pipeline durch deren Wirtschaftszonen zu erhalten. |
Die Ostsee-Pipeline – weshalb der Kreml sie so dringend
braucht
(zu 111101)
Die neue Gaspipeline durch die Ostsee sei notwendig, "um den steigenden
Gasimportbedarf zu decken", behauptete Nord-Stream-Chef Matthias Warnig
bei der offiziellen Inbetriebnahme der 1.224 Kilometer langen Röhre. Das
klingt für Unkundige einleuchtend, lenkt aber von den tatsächlichen
Hintergründen des Milliardenprojekts ab. Die Ostsee-Pipeline wäre
nie zustande gekommen, wenn es nur darum ginge, noch mehr Kapazitäten für
den russischen Gasexport nach Westeuropa bereitzustellen. Sie wäre sogar
schlicht überflüssig. In Wirklichkeit will die russische Gazprom auf
diese Weise die osteuropäischen Gastransitländer umgehen, um diese
als Abnehmer besser unter Druck setzen können. Zugleich will sie konkurrierenden
Pipeline-Projekten das Wasser abgraben, die darauf gerichtet sind, die einseitige
Abhängigkeit Westeuropas von russischen Gaslieferungen zu mildern. Außerdem
erhofft sie sich verbesserte Chancen für den Direkteinstieg in den europäischen
Energiemarkt.
Neue Situation nach dem Zerfall der Sowjetunion
Solange die Sowjetunion noch existierte, gab es mit den Transitländern
keine Probleme: Sie waren entweder selber Bestandteil des Sowjetreichs, wie
die Ukraine und Weißrußland, oder gefügige Vasallen wie die
damalige Tschechoslowakei. Trotz aller politischen Gegensätze und Spannungen
galt der Kreml im Westen als absolut zuverlässiger Vertragspartner.
Das änderte sich nach dem Zerfall der Sowjetunion: Nun setzte der Kreml
die abgefallenen Teile des ehemaligen Imperiums unter Druck, um politische Zugeständnisse
oder zumindest die Zahlung höherer Erdgaspreise zu erreichen. Schon im
Oktober 1992 kam es so zum ersten Konflikt mit der Ukraine: Ohne Vorwarnung
und entgegen den vertraglichen Vereinbarungen kürzte Rußland seine
Erdgas-Lieferungen nach Westeuropa bis zur Hälfte. In Deutschland spürte
man davon zwar nichts, weil die Ruhrgas auf Speicher und Bezüge von anderen
Lieferanten ausweichen konnte. In der ehemaligen Sowjetrepublik Litauen kam
es aber zu einer schweren Energiekrise, die sogar Tote forderte (921005).
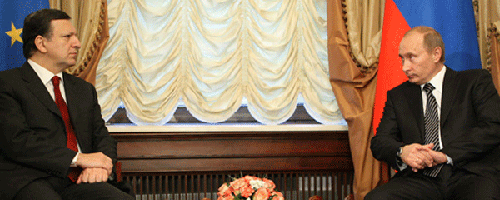 |
Sie konnten zueinander nicht kommen: Bei einem Treffen, das im Februar
2009 in Moskau stattfand, machte Kremlchef Putin (rechts) dem EU-Kommissionspräsidenten
Barroso (links) nochmals klar, daß er andere Vorstellungen von "Energiepartnerschaft"
hat und die "Energiecharta" in der seit 1998 gültigen Form
niemals ratifizieren wird.
Pressefoto Reg. RU
|
Die "Europäische Energiecharta" bleibt für
Rußland unverbindlich
In Rußland herrschte nun anstelle des Sowjetregimes eine Mafia aus neureichen
Kapitalisten, die mit den alten Kadern verschwistert war. Unter dem Präsidenten
Jelzin wurden die lukrativen Bereiche der Staatswirtschaft geradezu verschleudert.
Zumindest dienten sie nun als Pfründen einer neuen, korrupten "Elite",
die sich den Staat zur persönlichen Bereicherung angeeignet hatte. Das
galt vor allem für den Export von Gas und Öl, der mühelose Einnahmen
garantierte. Um die inländische Versorgung kümmerte man sich dagegen
kaum, weil hier nichts zu holen war. Die Wirtschaft stand vor dem Zusammenbruch
(920801). Über Jahre hinweg mußte die Bevölkerung
sogar frieren, weil Gas- und Stromversorgung nicht funktionierten (010218).
Der Westen war durchaus bereit, mit den neuen Herrschern zu kooperieren, die
das Land ausplünderten. Aber auch der Export von Gas und Öl setzt
einigermaßen stabile politische Rahmenbedingungen voraus. Um diese zu
erreichen, wurde Ende 1991 die "Europäische Energiecharta" erfunden,
die Rußland im wesentlichen die Rolle eines Rohstofflieferanten zuwies
(911204). Auf dieser Basis hofften nun Konzerne wie
RWE, besser mit russischen Partnern ins Geschäft zu kommen (920304).
Es dauerte aber noch einige Zeit, ehe der Vertragsentwurf in 54 Artikeln präzisiert
(940601) und Ende 1994 schließlich in Lissabon
unterzeichnet werden konnte (941204).
Putin betreibt die Re-Nationalisierung der russischen Energiewirtschaft
Die russische Regierung unterschrieb das Dokument damals auch, hat es aber
niemals durch die Duma ratifizieren lassen, was Voraussetzung einer Verbindlichkeit
wäre. Als der Vertrag 1998 in Kraft trat und die meisten von insgesamt
49 Staaten ihn ratifiziert hatten, stellte Moskau lediglich eine baldige Ratifizierung
in Aussicht (980405). Dazu kam es aber auch später
nicht. Der seit 2000 regierende Präsident Putin hatte völlig andere
Vorstellungen von einer "Partnerschaft" mit dem Westen (090201).
Auf den Trümmern der Pseudo-Demokratie, die Jelzin hinterlassen hatte,
errichtete der ehemalige KGB-Agent Putin wieder ein straff-autoritäres
Regime. Zugleich beseitigte er manche Auswüchse des alten Systems, indem
er etwa den besonders korrupten Chef von Gazprom ablöste (010615)
und den weiteren Ausverkauf der nationalen Ressourcen an Privatinteressen stoppte.
Ende 2003 machte Putin unmißverständlich klar, daß er eine
Re-Nationalisierung der russischen Energiewirtschaft anstrebte (031117).
Den Oligarchen Chodorkowskij, der gerade über den Einstieg amerikanischer
Konzerne beim Ölkonzern Yukos verhandelte, ließ er kurzerhand verhaften
und nach einem Schauprozeß in stalinistischer Manier zu neun Jahren Lagerhaft
verurteilen (050610). Zugleich sicherte er sich die
Unterstützung der neureichen Kapitalisten-Clique, indem er ihr das zusammengeraffte
Vermögen bei Wohlverhalten beließ. Der Oligarch Abramowitsch verkaufte
deshalb sein Ölunternehmen Sibneft "freiwillig" für elf
Milliarden Euro an Gazprom (050914).
Die Ruhrgas verliert ihre Stellung als Alleinimporteur
Der Zerfall der Sowjetunion berührte die Gaslieferungen und die Gültigkeit
der Verträge mit ausländischen Staaten nicht. Zumindest nicht im Falle
von Westdeutschland. Auf russischer Seite änderte sich lediglich die Organisationsform
der Gaswirtschaft, die aus einem ministeriellen Geschäftsbereich in den
Staatskonzern Gazprom umgewandelt wurde. Seit 1992 figuriert dieser Staatskonzern
als Aktiengesellschaft, an der zeitweilig auch die Ruhrgas mit bis zu 6,5 Prozent
beteiligt war (101211). Trotz der privatrechtlichen
Organisationsform blieb Gazprom jedoch faktisch ein Staatsmonopolist, der dem
Kreml als wichtigste Einnahmequelle dient und mit straffer Hand als politische
Allzweckwaffe eingesetzt wird.
In der Bundesrepublik hatte in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre
die Umstellung von Stadtgas auf Erdgas begonnen. Damit einher ging der Bau eines
bundesweiten Pipeline-Systems, das aus den neu erschlossenen holländischen
Gasvorkommen gespeist wurde (siehe ENERGIE-WISSEN).
Ab 1973 begannen zusätzlich die Einspeisungen aus Rußland, und schon
in den achtziger Jahren wurde die Sowjetunion zum wichtigsten Erdgas-Lieferanten
der Bundesrepublik. Heute kommt der größte Teil des Erdgases aus
Rußland (37 Prozent), Norwegen (26 Prozent) und den Niederlanden (18 Prozent).
Die inländische Förderung deckt 15 Prozent des Bedarfs. Der Rest von
vier Prozent entfällt vor allem auf Dänemark und Großbritannien
(siehe ENERGIE-WISSEN).
Die damalige DDR bezog seit 1973 ebenfalls Erdgas aus Rußland. Es handelte
sich jedoch um weit geringere Mengen, die hauptsächlich industriellen Zwecken
dienten. In den ostdeutschen Haushalten dominierte weiterhin das Stadtgas. Die
Erdgaslieferungen für West- und Ostdeutschland nahmen denselben Weg über
die Ukraine in die Tschechoslowakei, wo dann ein Strang zum Grenzübergang
Waidhaus in Bayern und ein anderer zur Übergabestelle Sayda in Sachsen
führte.
Für die acht Milliarden Kubikmeter, die bisher die DDR bezog, entfiel
mit der "Wende" allerdings der Vertragspartner, da die Ostberliner
Regierung verschwunden war. Der Chemiekonzern BASF und seine Tochter Wintershall
nutzten diese Situation, um die Ruhrgas aus der bisherigen Rolle des Alleinimporteurs
zu verdrängen und ein eigenes Pipeline-Netz aufzubauen. Das kapitalistisch
gewendete Kreml-Regime half dabei, indem es dem ostdeutschen Ferngasverteiler
VNG, der damals noch von Ruhrgas dominiert wurde, mit einem Lieferstopp drohte
(920218). Fortan gab es auf deutscher Seite zwei Importeure,
die der Kreml gegeneinander ausspielen konnte, um sich Zutritt zum westeuropäischen
Markt zu verschaffen (siehe Hintergrund).
Aus ehemaligen Sowjet-Pipelines sind Transitleitungen geworden
Mit der Drohung des Lieferstopps setzte der Kreml nun auch seine Preisforderungen
gegenüber den ehemaligen Sowjetrepubliken Ukraine und Weißrußland
durch. Als formal unabhängige Staaten bildeten diese eine Art Niemandsland
zwischen dem geschrumpften Moskauer Machtbereich und der erweiterten Europäischen
Union, die inzwischen auch die ehemaligen osteuropäischen Vasallen-Staaten
Moskaus und baltischen Sowjetrepubliken umfaßte. Wirtschaftlich waren
diese beiden Staaten aus der Konkursmasse der ehemaligen Sowjetunion kaum lebensfähig.
Es fiel ihnen äußerst schwer, die steigenden Preise für den
Eigenbedarf an Gas zu zahlen, die Gazprom jetzt verlangte. Einen Preisaufschub
oder -nachlaß gewährte Gazprom aber nur gegen wirtschaftliche oder
politische Konzessionen, die darauf abzielten, diese Länder wieder in die
russische Einflußsphäre einzubinden. Vor allem wollte der Kreml wieder
die Verfügungsgewalt über die Gasleitungen erlangen. Denn das einzige
Druckmittel und Faustpfand, über das die abtrünnigen Staaten verfügten,
waren die zu Sowjetzeiten gebauten Gas-Pipelines, die durch ihr Gebiet nach
Westen führten und nunmehr zu Transitleitungen geworden waren.
Weißrußland muß sich dem Kreml beugen
Im Januar 2004 stoppte Rußland einen Tag lang die Gaslieferungen an Weißrußland,
um den dort herrschenden Diktator Lukaschenko zu wirtschaftspolitischen Zugeständnisse
zu bewegen (040117). Drei Jahre später drohte
Gazprom dem Regime in Minsk erneut mit einem Lieferstopp, um die Verdoppelung
des Gaspreises durchzusetzen. Außerdem erlangte Gazprom nun die Hälfte
der Anteile am weißrussischen Pipeline-Betreiber Beltransgas. Die Russen
profitierten so zugleich von der Erhöhung der Transitpauschale, die Minsk
als kleiner Ausgleich gewährt wurde (070104).
Als Beltransgas nicht pünktlich zahlte, drohte Moskau prompt erneut mit
einem Lieferstopp (070809).
Zuletzt verhängte Gazprom im Juni 2010 einen Lieferstopp, um Minsk zur
Bezahlung von Gasrechnungen zu zwingen. Da knapp zwanzig Prozent der russischen
Gaslieferungen für Westeuropa durch Weißrußland erfolgen, kam
Diktator Lukaschenko auf die Idee, seinerseits die Transitlieferungen zu stoppen.
Er wollte so mit Hilfe der EU-Staaten politischen Druck auf seine Gegenspieler
im Kreml ausüben. Es blieb jedoch beim Versuch. Binnen weniger Tage war
auch dieser Konflikt zugunsten von Gazprom entschieden (100604).
Wirtschaftlich wie politisch war das Minsker Regime viel zu sehr von den Machthabern
im Kreml abhängig, um sich ernsthaft mit diesen anlegen zu können.
Ukraine beantwortet Lieferstopp mit Anzapfen der Transitleitungen
Die Ukraine besaß im Vergleich mit Weißrußland ein größeres
Eigengewicht, zumal durch die "orangene Revolution" des Jahres 2004
der moskaufreundliche Präsident Janukowitsch gestürzt worden war.
Im folgenden Jahr erhöhte Gazprom der Ukraine den Preis für tausend
Kubikmeter Erdgas von 50 auf 160 Dollar, während Weißrußland
auch nach der erzwungenen Erhöhung nur 46 Dollar zahlen mußte (051204).
Da die Regierung in Kiew sich darauf nicht einlassen wollte, verwirklichte Gazprom
Anfang 2006 den angedrohten Lieferstopp. Mit der Kürzung des Kontingents
für die Ukraine schnitten sich die Russen allerdings nur ins eigene Fleisch,
denn die Ukraine zapfte die fehlenden Gasmengen nun aus den Transitlieferungen
ab. Leidtragende waren die Gazprom-Kunden in Westeuropa, die ihre vertraglich
vereinbarten Liefermengen nicht mehr in vollem Umfang erhielten. Es kam deshalb
zwischen Moskau und Kiew relativ schnell zu einem Kompromiß, der den Preis
faktisch nur von 50 auf 95 Dollar erhöhte. Es war aber insofern ein recht
fauler Kompromiß, als die Ukraine formal sogar einen Preis von 230 Dollar
akzeptierte und zum Herunterhandeln dieser Summe der Einschaltung von genauso
überflüssigen wie zwielichtigen Zwischenhändlern zustimmte (060101).
Gazprom geht etwas überlegter vor und zieht die Preisschraube
immer stärker an
Als die Ukraine auch den neuen Gaspreis nicht bezahlen konnte, der knapp verdoppelt
worden war, drohte Gazprom im Oktober 2007 erneut mit Lieferbeschränkungen.
Die Russen gingen diesmal aber behutsamer vor: Sie informierten vorher die EU-Kommission
und wiesen auf das Risiko hin, daß sich die Ukraine erneut an den Transitmengen
für Westeuropa schadlos halten könnte. Prompt sorgte man in Brüssel
dafür, daß die Ukraine ihre Zahlungsverpflichtungen anerkannte und
Gazprom die verlangten Summen erhielt (071011).
Gazprom blieb jedoch unersättlich: Ab 2008 stieg der Gaspreis für
die Ukraine auf 180 Dollar, nachdem die vorangegangenen Parlamentswahlen erneut
nicht im Sinne Moskaus ausgegangen waren. "Dieser Preis basiert nicht auf
Logik, sondern auf Korruption", meinte dazu die designierte neue Regierungschefin
Julia Timoschenko (071210). Das Sträuben half
ihr indessen nichts, zumal sie und der ukrainische Präsident Juschtschenko
zunehmend gegeneinander agierten, statt am selben Strang zu ziehen. Gazprom
drohte wieder mal mit einem Lieferstopp, und im Februar 2008 mußte Kiew
der Preiserhöhung zustimmen (080215). Im März
flammte der Streit nochmals auf, weil man sich über die Rolle der dubiosen
Zwischenhändler noch immer nicht einig geworden war. Gazprom kürzte
nun tatsächlich vorübergehend die Lieferungen und erzwang sich die
Berechtigung, zehn Prozent des ukrainischen Marktes direkt zu versorgen (080313).
Gasfluß Rußland – Ukraine
|
Gasfluß Ukraine – Westeuropa |
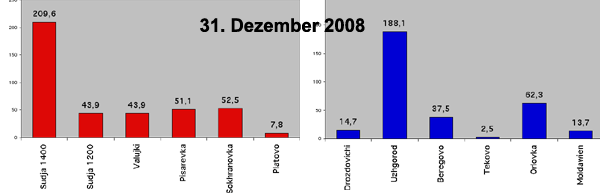 |
| Am 1. Januar 2009 sperrte Rußland zwei der sechs
Pipelines in die Ukraine. Die Gesamtmenge der Gaslieferungen sank dadurch
um rund 100 Millionen Kubikmeter täglich. Die restlichen vier Pipelines
speisten aber nicht kontinuierlich, sondern wechselnde Mengen ein, was
den Regelungsbedarf der Ukraine zusätzlich erhöhte. Vier Tage
später drehte Gazprom den Gashahn immer mehr zu. Am 6. Januar war
nur noch eine Pipeline in Betrieb. Ab dem 7. Januar kamen überhaupt
keine Lieferungen mehr. Die Ukraine machte daraufhin sämtliche fünf
Leitungen nach Westen und die nach Moldawien dicht, um die inländische
Versorgung sicherstellen zu können. |
Der Gasfluß durch die Ukraine wird zwei Wochen lang gestoppt
Es dauerte nur ein paar Monate, bis sich der Konflikt zum sechsten Mal zuspitzte
und einen weltweit beachteten Höhepunkt erreichte: Die Ukraine konnte ihre
für das Jahr 2008 aufgelaufenen Gasschulden von drei Milliarden Dollar
nicht in voller Höhe bezahlen und verlangte im Gegenzug eine Erhöhung
der Transitgebühren. Ohne Rücksicht auf die westeuropäischen
Kunden sperrte Gazprom daraufhin ab 1. Januar 2009 zwei der sechs Pipelines
in die Ukraine. In den folgenden Tagen drehten die Russen den Gashahn noch mehr
zu. Am 6. Januar war nur noch eine Pipeline in Betrieb. Ab dem 7. Januar kamen
überhaupt keine Lieferungen mehr. Die Ukraine machte nun ihrerseits sämtliche
Transitleitungen dicht, um die inländische Versorgung sicherstellen zu
können (090101).
Die Versorgung Westeuropas mit russischem Gas, die zu 80 Prozent über
die Ukraine erfolgt, wurde dadurch erheblich beeinträchtigt. Insgesamt
waren die russischen Gaslieferungen für europäische Abnehmer 13 Tage
lang unterbrochen. Die EU zeigte sich in hohem Maße besorgt und drängte
die Kontrahenten zu einer Einigung. Am 19. Januar unterzeichneten Moskau und
Kiew schließlich einen neuen Gasliefervertrag. Im Grunde enthielt er nur
das, worauf man sich im Herbst 2008 schon grundsätzlich verständigt
hatte – mit dem Unterschied, daß inzwischen das Vertrauen in die
Zuverlässigkeit der russischen Gaslieferungen in Westeuropa tiefgreifend
beschädigt und auch sonst viel politisches Porzellan zerschlagen worden
war.
 |
Am 19. Januar einigten sich die Regierungschefs Julia Timoschenko
und Wladimir Putin endlich auf einen neuen Gasliefervertrag. Die Unterzeichnung
der Vereinbarung überließen sie ihren jeweiligen Gas-Chefs:
Links unterschreibt Oleg Dubin für die ukrainische Naftogaz, rechts
Alexey Miller für Gazprom.
Pressefoto
Reg. UA |
|
Ukraine häuft weitere Schulden zur Bezahlung der Gasrechnungen
an
Natürllich fehlte der Ukraine weiterhin das Geld, um den von Gazprom erpreßten
Preis tatsächlich bezahlen zu können. Die EU organisierte deshalb
im März 2009 eine Investorenkonferenz, um notwendige Maßnahmen
zur Modernisierung des ukrainischen Gassystems zu erörtern. Der Kreml
reagierte gereizt, weil er das als Übergriff in seine Einflußsphäre
empfand (090307). Hingegen hatte er nichts dagegen,
daß Brüssel einfach nur die Gasrechnungen beglich. Im Mai 2009
forderte er sogar die EU zu finanzieller Hilfestellung auf, weil der Ukraine
die Zahlungsfähigkeit drohe (090501).
Die Regierung in Kiew wandte sich ihrerseits an die EU und beantragte einen
Kredit von 4,2 Milliarden Euro, um einen erneuten russischen Lieferstopp
zu vermeiden (090606). Ein Kredit des Internationalen
Währungsfonds half vorerst aus den schlimmsten Finanznöten (090810).
Aber schon die Gasrechnung für den Oktober wurde wieder nur mühsam
beglichen (091107).
In Kiew kommt wieder ein Kreml-freundliches Regime an die
Macht
Die russische Zermürbungstaktik trug dazu bei, daß bei der Präsidentenwahl
im Februar 2010 der Kreml-freundliche Janukowitsch wieder an die Macht gelangte
und auch im Kiewer Parlament eine neue Regierungsmehrheit zustande kam.
Die Russen honorierten den Wechsel mit einem Rabatt von 30 Prozent auf den
vereinbarten Gaspreis und durften dafür ihre Schwarzmeerflotte weiterhin
auf der Krim stationieren (100402). Innenpolitisch
nahm die Ukraine wieder Züge einer Diktatur an. Das neue Regime begnügte
sich nicht damit, sämtliche Schlüsselstellungen zu besetzen und
Oppositionelle aus ihren Ämtern zu verjagen. Unter dem Vorwand der
Korruptionsbekämpfung verhaftete es Timoschenko und andere Mitglieder
der früheren Regierung (110814). Im Oktober
2011 wurde Timoschenko durch eine willfährige Justiz zu sieben Jahren
Haft und einer Geldstrafe von 142 Millionen Euro verurteilt, weil sie den
Gasliefervertrag vom 19. Januar 2009, der den zweiwöchigen Lieferstopp
beendete, zu ungünstigen Konditionen abgeschlossen habe (111007).
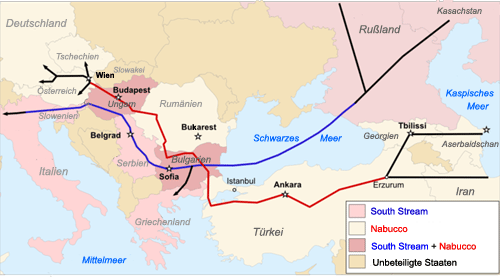 |
South Stream gegen Nabucco: Die EU-Mitglieder Bulgarien und Ungarn
sind in beide Projekte eingebunden. Die "South Stream"-Abzweigung
nach Griechenland soll bis Italien verlängert werden. |
EU will mit "Nabucco" unabhängiger von Lieferungen
aus Rußland werden
Vor dem hier skizzierten Hintergrund wird verständlich, weshalb Gazprom
so großen Wert auf den Bau einer Pipeline-Verbindung durch die Ostsee
legte: Es ging zunächst einmal darum, den Transitländern das einzige
Faustpfand zu nehmen, über das sie verfügten, um sich gegen die
Preis-Diktate von Gazprom zu wehren. Zunehmende Bedeutung erlangte das Projekt
aber auch deshalb, weil die EU schon seit längerem die Abhängigkeit
vom russischen Gas als Gefahr erkannte und auf Abhilfe sann. Im Juni 2006
vereinbarte sie deshalb mit Österreich, Rumänien, Bulgarien und
der Türkei den Bau der Pipeline "Nabucco", um Erdgas aus
der Region um das Kaspische Meer nach Europa zu leiten (060605).
Voraussetzung wäre allerdings eine hinreichende Kapazitätsauslastung
der neuen Leitung. Um diese zu verhindern, plante der Kreml den Bau der
konkurrierenden Pipeline "South Stream" durch das Schwarze Meer
(070612). Auch die Ostsee-Pipeline fügte sich
gut in dieses Blockade-Konzept.
Nach dem zweiwöchigen Lieferstopp im Januar 2009 wurde "Nabucco"
in Brüssel als noch dringlicher angesehen. Der amtierende EU-Ratspräsident
Topolanek bezeichnete den Bau einer solchen Pipeline zur Umgehung Rußlands
als "strategisches Projekt von entscheidener Bedeutung für das
wirtschaftliche Wohlergehen und die politische Unabhängigkeit von ganz
Europa". Die geplante Pipelines durch die Ostsee und das Schwarze Meer
änderten nichts an der Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen.
Sie seien sogar eine "direkte Bedrohung" für das EU-Projekt
(090102).
 |
Man hat sich arrangiert: Am Festakt zur Eröffnung der Bauarbeiten
an der Ostsee-Pipeline nahm auch der neue EU-Energiekommissar Günther
Oettinger teil. Neben ihm (ganz links) repräsentiert Staatssekretär
Bernd Pfaffenbach vom Bundeswirtschaftsministerium die 2,8-Milliarden-Bürgschaft
der Bundesregierung für das Projekt. Rechts von Oettinger sieht
man Gazprom-Chef Alexey Miller, den russischen Präsidenten
Dimitri Medwedew, den Nord-Stream-Aufsichtsratsvorsitzenden Gerhard
Schröder und Nord-Stream-Geschäftsführer Matthias
Warnig.
Pressefoto): Nord Stream
|
Brüssel spricht statt "Bedrohung" nur noch
von "Diversifizierung"
Kurz darauf schlug Brüssel eine diplomatischere Tonart an und bezeichnete
die beiden russischen Projekte als Beitrag zu einer "Diversifizierung,
bei der die Gasversorgung Westeuropas auf unterschiedlichen Wegen erfolgt"
(090201). Im April 2009 begrüßte
ein internationaler Gas-Gipfel, der unter Beteiligung Rußlands in
Sofia stattfand, die Verwirklichung aller Gas-Projekte im Bereich des Schwarzen
Meeres und der östlich davon gelegenen kaspischen Regionen (090402).
Als ein Jahr später mit dem Bau der Ostsee-Pipeline begonnen wurde,
erschien auch der neue EU-Energiekommissar Oettinger zu dem Festakt (100405).
Hinter der neuen Fassade dauerte aber die alte Rivalität fort, und unter
dem Tisch trat man sich so kräftig ans Schienbein, wie es eben ging. So
gelang es dem Kreml, zusätzlich zu BASF und E.ON auch noch die niederländische
Gasunie und Frankreichs GDF Suez für den Bau der Ostsee-Pipeline ins Boot
zu holen. Die französische EDF wollte sich außerdem an "South
Stream" beteiligen, wo bisher die italienische ENI der einzige Partner
von Gazprom war (091102). Die EU umwarb unterdessen
die potentiellen Lieferländer für "Nabucco" und trieb das
Vorhaben weiter voran (090501). Im Juli 2009 wurde
ein neues Regierungsabkommen zur Verwirklichung des Projekts unterzeichnet,
an dem sich insgesamt sechs Konzerne beteiligten (090703).
Der deutsche RWE-Konzern war seit 2008 mit dabei (080206)
und blieb es, obwohl Gazprom auch ihn für "South Stream" zu gewinnen
versuchte (100909).
Mit ehemaligen DDR-Funktionären an der Spitze bereitet
Gazprom den Einstieg in den deutschen Markt vor
 |
Zwei deutsche Leistungsträger auf der Gehaltsliste von
Gazprom: Gerhard Schröder (links) hatte sich schon als Bundeskanzler
für das Projekt eingesetzt, bevor er Aufsichtsratsvorsitzender
der Nord Stream wurde. Geschäftsführer Matthias Warnig
war früher in der DDR-Handelsmission in Düsseldorf tätig
und bekam für seine damaligen Verdienste von Stasi-Chef Mielke
einen Orden.
Pressefoto): Nord Stream
|
Der dritte Hintergedanke beim Bau der Ostsee-Pipeline war die Absicht von Gazprom,
direkt in den deutschen und europäischen Energiemarkt einzusteigen. Sie
wurde erstmals Ende 2005 offiziell verkündet (051203).
Die deutsche Gazprom-Tochter ZZG Zarubezhgaz-Erdgashandel-Gesellschaft mbH,
deren Name noch reichlich russisch klang, wurde zu diesem Zweck in in Gazprom
Germania GmbH umbenannt. Zugleich begann die Gazprom damit, viel Geld für
PR-Zwecke auszugeben, um ihr Image in der deutschen Öffentlichkeit zu verbessern
(061011). Sie hatte das auch bitter nötig, zumal
es bei der Gazprom Germania anscheinend ähnlich zuging wie beim Mutterkonzern.
Im August 2008 berichtete der "Spiegel", daß an der Spitze des
Unternehmens ehemalige DDR-Funktionäre und Mitarbeiter des Ministeriums
für Staatssicherheit stünden. Geschäftsführer Hans-Joachim
Gornig, den die DDR einst mit dem "Vaterländischen Verdienstorden
in Bronze" auszeichnete, habe zudem in die eigene Tasche gewirtschaftet
(080804).
Als es Gazprom 2006 endlich gelang, zusammen mit BASF und E.ON ein Gemeinschaftsunternehmens
zum Bau der Ostsee-Pipeline zu gründen, wurde mit Matthias Warnig ein ehemaliger
Funktionär des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit zum Geschäftsführer
bestellt. Zuvor war Warnig für die Dresdner Bank als Rußland-Experte
tätig gewesen. Er kannte diesen Arbeitgeber bereits aus seiner früheren
Tätigkeit, denn als MfS-Offizier bei der Handelsvertretung der DDR in Düsseldorf
hatte auch die Dresdner Bank zu seinen Spionageobjekten gehört.
Der abgehalfterte Bundeskanzler Gerhard Schröder wird
Gehaltsempfänger von Gazprom
Mehr Aufsehen erregte jedoch der neue Aufsichtsratsvorsitzende des Gemeinschaftsunternehmens:
Es war der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Der hatte soeben die
Bundestagswahlen verloren und hielt Ausschau nach einer neuen einträglichen
Tätigkeit. Da traf es sich gut, daß Kremlchef Putin ihm zu diesem
Posten verhalf. Der "Genosse der Bosse" hatte auch in dieser Hinsicht
keinerlei Berührungsängste. Schon als Bundeskanzler hatte er den autoritären
Kreml-Herrscher einen "lupenreinen Demokraten" genannt. Nun übernahm
er als Gehaltsempfänger von Gazprom die Aufsicht über das Unternehmen
– mit einem ehemaligen MfS-Agenten als Geschäftsführer unter
sich und einem ehemaligen KGB-Agenten als Freund und Gönner über sich.
Polen und die baltischen Staaten verweigern eine Verlegung
durch ihre Gewässer
Das Projekt der Ostsee-Pipeline wurde nicht nur von den Transitländern
Ukraine und Weißrußland als Schwächung der eigenen Position
empfunden. Ähnlich erging es Polen und den baltischen Ländern. Besonders
groß war deren Widerstand, als sie noch nicht der EU angehörten (040404)
und als Mitglieder der Gemeinschaft auf einen gewissen Schutz gegenüber
russischen Pressionen hoffen durften. Im Unterschied zur Ukraine und zu Weißrußland
verfügten sie aber über ein handfestes Instrument zur Verhinderung
der Leitung: Sie untersagten deren Verlegung durch ihre Gewässer.
Die Ostsee ist so klein, daß eine Pipeline von Rußland nach Deutschland
nirgendwo durch internationale Hoheitsgewässer verlegt werden kann. Vielmehr
grenzen die "Ausschließlichen Wirtschaftszonen" der Anrainerstaaten
direkt aneinander (091102). Da die baltischen
Staaten und Polen ihre Zustimmung verweigerten, war es für die Russen von
Anfang an sehr wichtig, von Finnland, Schweden und Dänemark die Erlaubnis
zur Verlegung durch deren Wirtschaftszonen bzw. sogar nationalen Hoheitsgewässer
zu erhalten.
Skandinavier verlieren das strategische Interesse an der Pipeline
Das erklärt wiederum, weshalb sich Gazprom 1997 zunächst mit dem
finnischen Gas- und Ölunternehmen Neste Oy zusammentat, das kurz darauf
mit dem Stromversorger Imatran Voima Oy zum Fortum-Konzern fusionierte. Die
Finnen wollten in Lubmin ein großes GuD-Kraftwerk errichten und mit Hilfe
der neuen Pipeline betreiben. Der schwedische Vattenfall-Konzern verfolgte ebenfalls
ein solches Projekt (980821).
Die Skandinavier setzten sich auch erfolgreich gegen die damalige Veag durch,
die den Standort Lubmin für sich beanspruchte. Sie verloren dann aber aus
unterschiedlichen Gründen das Interesse: Die Finnen änderten ihre
Strategie und zogen sich ganz aus Deutschland zurück (020401).
Den Schweden paßte die Stromerzeugung mit Gas auch nicht mehr ins geschäftliche
Konzept, weil sie mit Veag, Laubag, Bewag und HEW sämtliche ostdeutschen
Braunkohlekraftwerke übernahmen (010506).
Hinzu kam, daß der deutsche Platzhirsch Ruhrgas das Projekt einer Pipeline
durch die Ostsee ablehnte und zu verhindern versuchte. Die Ruhrgas war zwar
der deutsche Hauptkunde von Gazprom. Aber gerade deshalb verfolgte sie mit großem
Argwohn die Pläne der Russen, sich nicht mehr auf die Rolle des Lieferanten
zu beschränken. Schon 1990 hatte sich Gazprom mit dem Chemiekonzern BASF
zusammengetan, um Einfluß auf den Gasvertrieb in Deutschland zu gewinnen.
Im Oktober 1991 entbrannte zwischen BASF und Ruhrgas sogar ein offen ausgetragener
"Gaskrieg" um die Vorherrschaft beim ostdeutschen Ferngasunternehmen
VNG (911004), der erst 1994 beigelegt wurde (940107).
BASF und E.ON zweifeln an der Wirtschaftlichkeit des Projekts
Im Mai 2005 stiegen die Finnen endgültig aus der North Transgas Oy aus,
die Gazprom als Projektgesellschaft für den Bau der Ostsee-Pipeline gegründet
hatte. Ersatzweise bemühten sich die Russen nun um die BASF und E.ON als
neue Partner. Die BASF-Tochter Wintershall war mit Gazprom schon seit längerem
über das Gemeinschaftsunternehmen Wingas verbandelt und hatte sich im Juli
2003 zusätzlich in das Gemeinschaftsunternehmen "Achimgaz" zur
Förderung von Erdgas aus dem Achimov-Horizont des Urengoy-Feldes einbinden
lassen (030716). Der E.ON-Konzern war 2003 in den Besitz
des deutschen Gazprom-Hauptkunden Ruhrgas gelangt, weil der Einspruch des Bundeskartellamts
durch eine Sondererlaubnis der rot-grünen Bundesregierung von Gerhard Schröder
ausgehebelt wurde (020701). Diese Ministererlaubnis
stand indessen rechtlich auf so schwachen Füßen, daß E.ON sich
mit den klagenden Konkurrenten außergerichtlich einigen mußte (030101).
In diesem Zusammenhang mußte E.ON auch die Fortum-Beteiligung an dem GuD-Projekt
in Lubmin übernehmen (030101). Dennoch waren die
beiden deutschen Konzerne von dem Projekt zunächst nicht sonderlich angetan.
Sie hegten starke Zweifel an seiner Wirtschaftlichkeit, weil die Kapazität
der vorhandenen Transitleitungen völlig ausgereicht hätte und die
gaspolitischen Ziele des Kreml nicht die ihrigen waren.
Nur widerstrebend ließ sich E.ON von Gazprom dazu bewegen, wenigstens
eine Absichtserklärung zum Bau der Ostsee-Pipeline abzugeben. Die Unterzeichnung
der Erklärung kam dann aber doch nicht zustande, sondern wurde kurz vor
dem geplanten Termin im Oktober 2003 abgesagt (031009).
Um die russische Seite zu beschwichtigen, unterzeichnete E.ON im Juli 2004 eine
Absichtserklärung zur weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit mit Gazprom
inklusive Ostsee-Pipeline und gemeinsamer Erdgasförderung (040808).
Die Erklärung war jedoch sehr allgemein gehalten und enthielt keine konkreten
Zusagen.
Gazprom spielt die deutschen Konzerne gegeneinander aus und
holt beide mit ins Boot
Das genügte den Russen nicht. Sie spielten nun E.ON und BASF gegeneinander
aus, um sie beide mit ins Boot zu holen. Im April 2005 vereinbarte Gazprom mit
der BASF die gemeinsame Erschließung und Ausbeutung des neuen Gasfelds
Jushno Russkoje in Nordsibirien und gleichzeitig den Bau einer Pipeline durch
die Ostsee für den Erdgastransport von Rußland nach Deutschland (050404).
Die BASF-Tochter Wintershall stieg damit in zwei Projekte ein, bei denen bisher
E.ON als Partner von Gazprom galt.
E.ON mußte nun mitziehen, um nicht der BASF das Feld zu überlassen.
Bei der Beteiligung am Gasfeld Jushno Russkoje gelang das erst nach vier
Jahren (081010). Sehr schnell ging dagegen die
Beteiligung an der Ostsee-Pipeline über die Bühne: Schon im September
2005 kam es zu einer Vereinbarung über den Bau der "Nordeuropäischen
Gasleitung" (NEGP) und die Gründung eines entsprechenden Gemeinschaftsunternehmens,
an dem Gazprom mit 51 Prozent und BASF und E.ON mit jeweils 24,5 Prozent
beteiligt sein sollten (050902). Die Unterzeichnung
der Grundsatzvereinbarung erfolgte in Anwesenheit des deutschen Bundeskanzlers
Gerhard Schröder und des russischen Präsidenten Putin. Die neugegründete
NEGP, die kurz darauf in "Nord Stream AG" umbenannt wurde, nahm
ihren Sitz im Schweizer Steuerparadies Zug.
 |
 |
| Das pompöse Gebäude im Schweizer Steuerparadies
Zug, in dem die Nord Stream AG ihren Firmensitz hat (links), kann
nicht darüber hinwegtäuschen, daß alle wichtigen Entscheidungen
in Moskau getroffen werden, wo das Gazprom-Unternehmen seit 2007 eine
Zweigniederlassung unterhält (rechts). |
Die abgewählte Schröder-Regierung verhilft Gazprom
schnell noch zu einer Bürgschaft
Zwei Wochen später verlor Schröder die Bundestagswahlen. Das hinderte
die abgewählte Regierung indessen nicht, der soeben gegründeten neuen
Gazprom-Tochter NEGP eine Bürgschaft in Höhe von knapp einer Milliarde
Euro zu gewähren (060406). Die Zusage erfolgte
kurz vor der Amtsübergabe an das neue Kabinett der schwarz-roten Koalition
(051102) und blieb zunächst geheim. Nicht verheimlichen
ließ sich allerdings, daß Schröder im Dezember 2005 in die
Dienste von Gazprom trat, indem er Vorsitzender des NEGP-Aufsichtsrats wurde.
Es gab deshalb eine Debatte im Bundestag, in der über den früheren
Bundeskanzler wenig Schmeichelhaftes gesagt wurde (051202).
Als ein Vierteljahr später die Kreditzusage bekannt wurde, entstand sogar
der Eindruck, als habe sich der abgehalfterte SPD-Politiker seinen hochdotierten
neuen Job durch Amtsmißbrauch erkauft. Schröder bestritt indessen
einen solchen Zusammenhang. Angeblich wußte er nicht einmal von der Kreditgarantie
(060406). Die Gazprom sprang ihrem hochdotierten neuen
Angestellten zur Seite, indem sie im April 2006 wissen ließ, daß
sie die Bürgschaft nicht in Anspruch zu nehmen gedenke (060507).
Ausschlaggebend für den Verzicht war aber wahrscheinlich, daß die
Bürgschaft faktisch eine staatliche Beihilfe für die beteiligten Konzerne
E.ON und BASF darstellte und deshalb erst von der EU-Kommission hätte genehmigt
werden müssen.
Die schwarz-gelbe Regierung bürgt sogar für die dreifache
Summe
Der neue Bundeswirtschaftsminister Guttenberg (CSU) fädelte die Sache
geschickter ein: Im Februar 2009 kündigte er eine erweiterte Bürgschaft
für sogenannte Ungebundene Finanzkredite an, die bisher ausschließlich
die politischen Risiken internationaler Rohstoff- und Energieprojekte abdeckten.
Damit konnte die Vergabe einer neuen Bürgschaft für das Ostsee-Projekt
kaum noch als verbotene Beihilfe für die deutschen Gazprom-Helfer eingestuft
werden (090211). Ende des Jahres war es soweit: Die
schwarz-gelbe Bundesregierung bewilligte nun gleich zwei Bürgschaften zur
Finanzierung der Pipeline, die sich auf insgesamt 2,8 Milliarden Euro beliefen.
Die Geldspritze fand auch die Zustimmung des neuen Bundesaußenministers
Westerwelle (FDP), der sich im April 2006 über die von Schröders Regierung
gewährte Bürgschaft empört hatte und damals nicht einsehen wollte,
"warum der deutsche Steuerzahler für einen russischen Staatskonzern
geradestehen soll" (091205).
Trotz neuer Gesellschafter behält Gazprom das Sagen
So konnte dann im April 2010 mit der Verlegung der Pipeline begonnen werden.
Beim Festakt repräsentierte ein Staatssekretär die 2,8-Milliarden-Bürgschaft
der Bundesregierung. EU-Energiekommissar Oettinger war auch zugegen, und die
Kanzlerin Merkel säuselte in einer Video-Botschaft etwas von "Energie-Partnerschaft"
(100405). Inzwischen war es den Russen gelungen, auch
noch die niederländische Gasunie in das Ostsee-Konsortium einzubinden.
Das änderte natürlich nichts daran, daß Gazprom weiterhin die
Mehrheit und das Sagen hatte. Als dann auch noch der französische Energiekonzern
GDF Suez hinzukam, führte das ebenfalls nur zu einer Umschichtung unter
den Beteiligungen der Minderheitsgesellschafter.
Bei den Anschlußleitungen NEL und OPAL wird regulatorisch
getrickst
Die Gasunie beteiligte sich im Juni 2010 außerdem am Projekt der "Norddeutschen
Erdgasleitung" (NEL), über die das bei Lubmin ankommende russische
Erdgas weiter nach Westen transportiert werden soll. Zugleich wurde die Abkürzung
NEL neu interpretiert und stand fortan für "Nordeuropäische Erdgasleitung".
Beides diente dem Zweck, die NEL als angebliche "Verbindungsleitung zwischen
Deutschland und anderen Staaten" erscheinen zu lassen, um gemäß
§ 28a EnWG eine befristete Freistellung
von der Regulierung zu erreichen (100603).
Bei der nach Süden führenden Anschlußleitung OPAL war dies
bereits gelungen: Im Februar 2009 genehmigte die Bundesnetzagentur die Befreiung
dieser Leitung von der Regulierung, soweit die Gaslieferungen über
die Grenze nach Tschechien gehen. Allerdings braucht Tschechien das Gas
überhaupt nicht. Das Land wird bereits bestens über die bestehenden
Pipelines versorgt. Die Gastransporte von Lubmin über die sächsische
Grenze nach Tschechien werden vielmehr über das Pipeline-Projekt "Gazelle"
an den deutschen Grenzübergang Waidhaus weitergeleitet und dort in
die MEGAL eingespeist, die wiederum zahlreiche Abnehmer in Deutschland versorgt,
ehe sie weiter nach Frankreich führt (090306).
|